 |
| Druckversion |
|
|
| systeme Heft 2/1998 |
1/1998 - 2/1998 - Übersicht Strunk, Guido (1998): Die Selbstorganisationshypothese der Psychotherapie. Kritische Forderung nach mehr theoretischer Auseinandersetzung. In: systeme 12(2), S. 3-21. abstract: In systeme 11/2 (1997) wurde eine Arbeit von Thiele vorgestellt, in der es um den Nachweis der Selbstorganisationshypothese der Psychotherapie geht. Der vorliegende Beitrag stellt die ursprünglich von Tschacher et al. formulierte Hypothese im Kontext ihrer theoretischen Begründung aus der Synergetik dar. Es wird gezeigt, dass die Hypothese sich nicht, in der von den Autoren vorgeschlagenen Form, aus der Theorie begründen lässt. Die in der Hypothese postulierte Komplexitätsreduktion bedeutet eine unzulässige Abschwächung des durch die Theorie geforderten Unordnungs-Ordnungs-Überganges. Der Artikel plädiert für einen präziseren Umgang mit Begrifflichkeiten und theoretischen Begründungen. Abschließend wird auf die empirischen Belege zur Selbstorganisationshypothese der Psychotherapie eingegangen. Im Gegensatz zu den Vertretern der Hypothese wertet der Autor die bisherigen Belege als klares Votum gegen die Hypothese, da ein Unordnungs-Ordnungs-Übergang nicht nachgewiesen werden konnte. Gruber, Jann und Thomas Hess (1998): Die Beziehungstriade in der Schule und der Schulerfolg: Ein Zusammenhang zwischen den Wirklichkeitskonstruktionen zum Schulerfolg im Beziehungsdreieck Schüler-Lehrer-Eltern und dem Erleben des schulischen Alltages durch die Schüler und Schülerinnen. In: systeme 12(2), S. 23-35. abstract: Die empirische Untersuchung belegt, dass die Einschätzung der schulischen Situation von Jugendlichen durch die Schülerinnen selbst, ihrer Lehrerinnen und Eltern in starkem Maße unterschiedlich ausfällt. Das Wohlbefinden der Jugendlichen in der Schule steht in einem deutlichen Zusammenhang mit den verschieden wahrgenommenen schulischen Schwierigkeiten durch die Lehrpersonen und den Eltern: Bei unterschiedlichen Beurteilungen zeigt sich bei den Schülerinnen und Schülern eine deutlich negativere Befindlichkeit und ein massiv häufigeres Auftreten von Leistungsstörungen und Verhaltensschwierigkeiten. Aber auch die Lehrpersonen stehen mit ihren Bewertungen von schulschwierigen Jugendlichen oftmals alleine da. Zerbes, Renate (1998): Frauengeschichten. Über die Wirksamkeit systemischer Methoden in einer Wochengruppe. In: systeme 12(2), S. 36-51. abstract: Die vorliegende Arbeit versucht die Wirksamkeit systemischer Methoden in einer kontinuierlichen Wochengruppe anhand exemplarischer Fallbeispiele zu beschreiben, wobei die Auswirkungen auf einzelne Gruppenteilnehmerinnen und auf die Gesamtgruppe berücksichtigt werden. Die Arbeit mit der Gesamtgruppe als auch die Einzelarbeit vor der Gruppe werden hier am Beispiel einer Frauengruppe analysiert. Walter, Gerhard (1998): Stationäre Behandlung als Übergang. Projekt eines systemischen Konzeptes auf einer psychosomatischen Station eines Kinderspitals. In: systeme 12(2), S. 52-62. abstract: Der vorliegende Beitrag beschreibt ein systemisches Konzept für die stationäre Arbeit an einer kinderpsychiatrischen Krankenhausstation. Im Rahmen dieses Konzeptes werden narrative und lösungs- bzw. zielorientierte Grundsätze im stationären Kontext erprobt. Innerhalb des Konzeptes wurde ein systemisches Modell der Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen entwickelt. Der Artikel reflektiert Erfahrungen mit dem Modell. Friedlmayer, Stefanie, Judith Illetschek, Gabriele Egger, Nada Lajic, Anita Macher, Monika Strobl und Emina Tury (1998): Salto mortale - Bilinguale Kindergarten- und Hortpädagogik. Ein Beitrag zur Integration. In: systeme 12(2), S. 63-72. abstract: Der folgende Artikel versucht aus unterschiedlichen Positionen bzw. Berufsrollen ein Projekt zur Integration nicht-deutschsprachiger Kinder in Kindertagesheimen der Stadt Wien zu beschreiben. Der Beitrag wird von uns nicht nur deswegen als systemisch angesehen, weil er unterschiedliche Sichtweisen nebeneinander stellt, sondern auch weil dem gesamten Projekt ein Verständnis von Identität und In-Sprache-sein zugrunde liegt, das wir als systemisch bezeichnen wollen. |
|
||||||||
Besuche seit dem 27.1.2005: 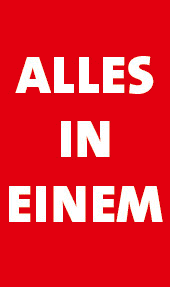  |
