 |
| Druckversion |
|
|
| Familiendynamik Heft 4/2001 |
| 1/2001 - 2/2001 - 3/2001 - 4/2001 - Überblick Hilker, Töns H. (2001): Das Buddenbrock-Syndrom. Ursachen des Niedergangs von Familienunternehmen. In: Familiendynamik 26(4), S. 338-358. abstract: Die Gründergeneration zahlreicher mittelständischer Familienunternehmen der Nachkriegszeit tritt ab. Mangels unzureichender Nachfolgeregelung sind viele Unternehmen, insbesondere der dritten Generation, mit Konkurs bedroht. Im Generationenablauf endogen wachsende Interessenkonflikte können nur im Sinne des gemeinsamen Unternehmenswohls gelöst werden, wenn die Teilsysteme Eigentümer-Unternehmer, Betrieb und Familie gemäß ihrer jeweiligen ökonomischen, psychologischen und sozialen Funktionsbedingungen durch adäquate Handlungsrechte institutionell ausdifferenziert werden So gesteuerte Professionalisierung und Soziabilität der Akteure sind Überlebensbedingung des Familienunternehmens. Simon, Fritz B. (2001): Die Familie des Familienunternehmens. In: Familiendynamik 26(4), S. 359-377. abstract: Die Familie und ihr Familienunternehmen können als zwei soziale Systeme betrachtet werden, die nach unterschiedlichen Kommunikationsregeln funktionieren. Sie sind eng miteinander gekoppelt und durchlaufen eine Koevolution. Wenn Familienmitglieder sich in beiden Systemen begegnen, so tun sie das in unterschiedlichen Rollen und Beziehungen. Mit der Vermischung beider Kontexte sind für die Familienmitglieder spezifische psychische Anforderungen und Belastungen verbunden. In unterschiedlichen Phasen des Lebenszyklus des Unternehmens (von der Gründungsphase bis hin zum Mehr-Generationen-Großfamilienunternehmen) ergeben sich unterschiedliche Rahmenbedingungen für die Familiendynamik. Es wird versucht, charakteristische Muster von Familien in der ersten, zweiten, dritten und weiteren Generationen zu beschreiben und damit verbundene Risiken (z. B. Symptombildung) und Ansätze von Lösungsstrategien aufzuzeigen. Haass-Wiesegart, Margaret (2001): Die »Dritte im Bunde« des Unternehmerpaares: die Bank. In: Familiendynamik 26(4), S. 378-387. abstract: Der Artikel untersucht die Beziehung von Familienunternehmen, Paardynamik und Banken in den kritischen Zeiten eines erhöhten Kapitalbedarfs durch Unternehmensgründung oder neue Liquiditätsprobleme eines bestehenden Unternehmens. Die Geschäftspraktiken von Banken und die Beziehungsangebote, die von ihnen dem Unternehmer gemacht werden, haben weitreichende Folgen für die Familiendynamik, speziell die Paardynamik. Es besteht eine charakteristische Dreiecksbeziehung, bei der sich einige typische - wenn auch nicht zwangsläufige - Interaktions- und Beziehungsmuster beobachten lassen. Da auch heute noch die Mehrzahl der Familienunternehmen von Männern geführt werden, wird diese Situation in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Die Darstellung beruht auf Erfahrungen in der paartherapeutischen Arbeit mit Unternehmerpaaren. Haas, Bettina (2001): Konflikt und Chance: Die Veränderung der Leitungsstruktur in einem Familienunternehmen. In: Familiendynamik 26(4), S. 388-402. abstract: Familienunternehmen sind für unsere Gesellschaft von großer Bedeutung. Leider ist aber die »Sterberate« der Familienunternehmen hoch. Nur etwa die Hälfte von ihnen wird erfolgreich an die nächste Generation übergeben. Liegt dies allein am Versagen der Söhne und Töchter der Firmengründer? Die Familie des Unternehmers hat neben spezifischen Stärken spezielle Schwächen, dass sie aber derart pathologisch ist, entspricht wohl doch nicht der Realität. Die vorliegende Studie versucht eine differenziertere Beschreibung und Erklärung für das oft beklagte Phänomen der Übergangskrisen. Sie verbindet dabei Teile aus verschiedenen Fällen zu einem Ganzen. Nagel, Reinhart, Margit Oswald & Rudolf Wimmer (2001): AROMA - Zwei Familien und ein Unternehmen suchen ihre Zukunft. Zur Zukunftssicherung in Familienunternehmen. In: Familiendynamik 26(4), S. 403-424. abstract: Familienunternehmen sind immer dann gefährdet, wenn sie im Zuge ihres Lebenszyklus Phasen diskontinuierlichen Wandels zu bewältigen haben. Solche die bisherigen Fundamente erschütternden Veränderungen stehen in der Regel an, wenn es an der Spitze dieser Unternehmen zu einem Generationswechsel kommt. Dieser Zeitpunkt erzwingt neue Stmkturen und das Aushandeln neuer Rollen in den betroffenen Eigentümerfamilien, ein Umstand, der das soziale Gefüge in diesen Familien häufig vor eine sehr ernste Belastungsprobe stellt. Gleichzeitig sind diese familialen Veränderungen auf das Engste mit einem Umbau der Führungsstrukturen im Unternehmen verknüpft. Auch dort wäre es eine Illusion zu glauben, die Nachfolger könnten so ohne weiteres in die Fußstapfen ihrer Vorgänger treten. In beiden sozialen Systemen, in der Familie wie im Unternehmen, braucht es ein den zu bewältigenden Problemen jeweils individuell angemessenes Management des Übergangs. Die vorliegende Arbeit untersucht anhand eines Fallbeispiels unterschiedliche Möglichkeiten dieses Übergangsmanagements. Sie diskutiert die Notwendigkeit des Entwickelns neuer Zukunftsentwürfe sowohl für die weichende Generation als auch für die beteiligten Familien als Ganzes. Die Arbeit verdeutlicht, wie erfolgskritisch dabei das Schaffen geschützter Kommunikationsräume ist, in denen die Interessensunterschiede unter Würdigung des in der Vergangenheit Geleisteten, aber mit dem Blick in die Zukunft neu ausgehandelt werden können. Sie zeigt ferner, wie ein solcher Generationswechsel parallel zum Wandel in der Familie die einmalige Chance bietet, das Unternehmen selbst strategisch neu auszurichten. Eine explizte Beschäftigung mit Zukunftsfragen ist vor allem für eigentümergeführte Familienunternehmen keine selbstverständliche Sache. Es gilt deshalb, eine Prozessarchitektur zu finden, die es ermöglicht, in der Form der Strategieentwicklung einen Musterwechsel vorzunehmen und dabei gleichzeitig neue Führungsstrukturen entstehen zu lassen, die den anstehenden Führungswechsel nachhaltig unterstützen. Simon, Fritz B. (2001): Von der Familie zur Organisation. Die Entwicklung der European Family Therapy Association (EFTA). In: Familiendynamik 26(4), S. 425-431. abstract: Unter allen therapeutischen Fachgesellschaften und Verbänden bilden die Familientherapeuten in Europa eine ungewöhnliche Ausnahme: Sie sprechen offiziell (seit 2001) mit einer Stimme, denn sie werden durch eine gemeinsame Organisation, die European Family Therapy Association (EFTA), vertreten. Angesichts der im therapeutischen Feld üblichen Zersplitterung in unterschiedliche Schulen, in miteinander konkurrierende Institute, sich bekämpfende und ihre jeweiligen Orthodoxievorstellungen verteidigende berufsständische Organisationen usw. ist dies nicht nur ungewöhnlich, sondern ein Politikum. Wenn man darüber hinaus bedenkt, dass Vertreter von mehr als zwanzig europäischen Nationen, deren Werte, Sprachen und kulturelle Muster teilweise sehr verschieden sind, sich auf eine gemeinsame Organisationsstruktur einigen konnten, so bedarf dies einer Erklärung. Wie es dazu kommen konnte, soll im Folgenden skizzenhaft dargestellt werden. Ziel ist zu zeigen, dass systemisches Wissen nicht nur im Umgang mit Klientensystemen zu kreativen Lösungen führen kann, sondern auch bei der (Um-)Strukturierung von Organisationen. |
|
||||||||
Besuche seit dem 27.1.2005: 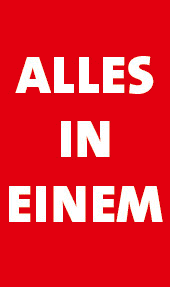  |
