 |
| Druckversion |
|
|
| Psychotherapie & Sozialwissenschaft Heft 2/2011 |
| 1/2011 - 2/2011 - Übersicht Kächele, Horst & Esther Maria Grundmann (2012): Editorial: Fehlerkultur. In: Psychoth.Soz. 13(2): S. 5-8 Haupt, Marie-Luise & Michael Linden (2012): Nebenwirkungen und Nebenwirkungserfassung in der Psychotherapie – Das ECRS-ATR-Schema. In: Psychoth.Soz. 13(2): S. 9-27. abstract: Während die Wirksamkeit von Psychotherapie gut belegt ist, werden unerwünschte Wirkungen nur randständig diskutiert, obwohl in 5–10 Prozent der Behandlungsfälle mit Nebenwirkungen zu rechnen ist. In diesem Beitrag werden Gründe für die Vernachlässigung des Themas Nebenwirkungen in der Psychotherapie diskutiert, wie z.B. fehlende Klassifikationssysteme, Probleme mit der Kausalitätsbestimmung oder auch die Haftbarkeit des Therapeuten. Anschließend wird der Kontext beschrieben, in denen sich Nebenwirkungen entwickeln und nach der begrifflichen Klärung ein System (Ereignis-Kontext-Relation-Schwere, ECRS-ATR) zur Erfassung und Dokumentation vorgeschlagen. Abschließend wird der Einsatz des ECRS-ATR Systems in der Praxis, Forschung und Ausbildung diskutiert. Fäh, Markus (2012): Wenn Psychoanalytiker Fehler machen – Möglichkeiten und Grenzen einer psychoanalytischen Fehlerkultur. In: Psychoth.Soz. 13abstract:: S. 29-48. abstract: Der Autor untersucht die Fragestellung, ob und wie in der Psychoanalyse sinnvoll eine Fehlerkultur betrieben werden kann. Der gegenwärtige Stand und die Mängel des heutigen individuellen und kollektiven Umgangs mit Behandlungsfehlern in der Psychoanalyse werden erörtert, Zielvorstellungen einer neuen offenen Fehlerkultur vorgestellt, Widerstände gegen eine solche Entwicklung analysiert. Klinische Beispiele illustrieren die verschiedenen Fehlerkategorien. Seidler, Klaus-Peter & Karin Schreiber-Willnow (2012): Therapeutische Fehler in der körperorientierten Psychotherapie und der Beitrag der Forschung für die Entwicklung einer Fehlerkultur. In: Psychoth.Soz. 13(2): S. 49-64. abstract: Ausgehend von der Auffassung, dass jedes therapeutische Verfahren spezifische Grenzen und Unzulänglichkeiten aufweist, werden spezifische Risiken der Körperpsychotherapie im Allgemeinen aufgeführt. Daran anschließend wird anhand einiger Ergebnisse von empirischen Studien zur Konzentrativen Bewegungstherapie (KBT) verdeutlicht, wie Forschung einen wichtigen Beitrag für Therapeuten liefern kann, ihre therapieschulenspezifische Überzeugungen zu reflektieren und kritisch in Hinblick auf mögliche Fehlentwicklungen der eigenen therapeutischen Praxis zu hinterfragen. Ein solches Hinterfragen ist der Entwicklung einer Fehlerkultur dienlich, was abschließend am Beispiel der KBT-Forschungswerkstatt dargelegt wird. Grundmann, Esther Maria (2012): Therapeut/-innen als Patient/-innen – Wenn Therapeut/-innen über ihre eigene Behandlung berichten. In: Psychoth.Soz. 13(12): S. 65-90. abstract: Im vorliegenden Aufsatz untersuche ich fünf Berichte von Therapeuten/-innen, die eine Zeit lang selbst in psychoanalytischer, psychotherapeutischer oder psychiatrischer Behandlung waren und ihre Erfahrungen in Texten festgehalten haben: Piet C. Kuiper (1991); Helmut Junker (1993); Tilmann Moser (2004); Margret Osterfeld (2006); Arnhild Lauveng (2008). Im Zentrum steht die Frage, ob die Ergänzung der Dritte-Person-Perspektive (die Sicht des Therapeuten/der Therapeutin) durch die Erste-Person-Perspektive (die Sicht des Patienten/der Patientin) zu neuen oder modifizierten Erkenntnissen führt bzgl. der institutionellen Rahmenbedingungen, der Behandlungstechnik und des Behandlungsverlaufs. Abschließend werden mögliche Konsequenzen für Theorie und Praxis angesprochen. Fegert, Jörg M., Heiner Fangerau, Tanja Besier & Ute Ziegenhain (2012): Fehlerprävention in der Kinderpsychiatrie. In: Psychoth.Soz. 13(2): S. 91-108. abstract: In Deutschland sind im Bereich des Kinderschutzes derzeit weder ein systematisches Risikomanagement noch eine Fehlerkultur implementiert. Aus anderen Bereichen wie beispielsweise der Luft- und Raumfahrt oder der Medizin – wo eine systematische Fehleraufarbeitung längst etabliert ist – existiert Wissen über strukturelle und inhaltlich-haltungsbezogene Variablen, die für den Aufbau einer Fehlerkultur von hoher Relevanz sind. Am Beispiel einer Presseanalyse bezogen auf Berichte von Kinderschutzfällen werden hier Möglichkeiten und Grenzen der Etablierung einer Fehlerkultur im Kinderschutz aufgezeigt. Kächele, Horst (2012): Einige (abschließende) Gedanken zum Fehlerbewusstsein der Profession. In: Psychoth.Soz. 13(2): S. 109-114 |
|
||||||||
Besuche seit dem 27.1.2005: 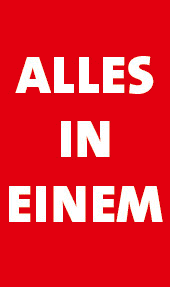  |
