 |
| Druckversion |
|
|
| Zeitschrift für Systemische Therapie und Beratung - Heft 3/2005 |
| 1/2005 - 2/2005 - 3/2005 - 4/2005 - Überblick Kjellberg, Eva (2005): Reflektierende Prozesse – ein übergreifender Ansatz in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Ambulanz. In: ZSTB 23(3), S. 149-155. abstract: Dargestellt wird die Arbeit in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Ambulanz im Norden von Schweden, die für alle aufkommenden kinder- und jugendpsychiatrischen Probleme in der Region zuständig ist. In Diagnostik, Therapie und Forschung wird berücksichtigt, dass wir selbst Teil des Geschehens sind und den Kontext beeinflussen. Gemeinsam mit den Patienten entwickeln wir etwas, das für die Patienten und für uns selbst nützlich ist. Dies fördert einen Prozess von der Diagnostik und Behandlung hin zu Entwicklung und Evaluation, zu etwas, mit dem „unsere“ Familien und Partner – ebenso wie wir selbst – sehr zufrieden sind. Küttner, Enno (2005): Das Wolverhampton City Modell einer gemeindenahen systemisch orientierten kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung. In: ZSTB 23(3), S. 156-165. abstract: Einer Kurzbeschreibung des historischen und politischen Hintergrunds der kinder- und jugendpsychiatrischen Dienste im Zusammenhang neuer Entwicklungen aller Dienste und Einrichtungen für Kinder und Jugendliche folgt die Darstellung des Wolverhampton City Modells der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung. Die Beschreibung von vier Teams geschieht sowohl von einer organisatorischen als auch von einer klinischen Perspektive. Fallbeispiele veranschaulichen, dass die Versorgung hauptsächlich in der Gemeinde stattfindet und selbst psychiatrische Krisenpatienten ambulant behandelt werden. Dies geschieht so aus verschiedenen Gründen: Erstens gibt es nur wenige kinder- und jugendpsychiatrische Betten in den West Midlands. Zweitens hat diese Versorgungsrealität dazu geführt, in allen Krisenfällen systematisch nach Stärken und Unterstützungsmöglichkeiten innerhalb der Familie und des sozialen Netzwerks der Klienten zu suchen. Individuelle professionelle Unterstützungssysteme und Behandlungspläne mit verteilten Verantwortlichkeiten werden entwickelt unter Einbeziehung der Jugendlichen und ihrer Familien. Am Ende des Artikels reflektiert der Autor über weitere bevorstehende Veränderungen und Herausforderungen der kinder- und jugendpsychiatrischen Dienste in England. Asen, Eia (2005): Von Multi-Institutionen-Familien zur Selbsthilfe. In: ZSTB 23(3), S. 166-171. abstract: Multi-Institutionen-Familien sind meist Multiproblemfamilien, die oft als hilf- und hoffnungslos angesehen werden. Der Kontext der Multifamilientherapie ermöglicht es diesen Familien und ihren oft schwer symptomatischen Mitgliedern, sich mit anderen Familien auszutauschen, ihre eigenen Ressourcen und Kompetenzen zu entwickeln und hilf-„reich“ statt hilf-„los“ zu sein. Das bedeutet, dass die systemischen Experten sich vor allem als Katalysatoren verstehen müssen, so dass ein Prozess der Selbsthilfe in die Wege geleitet wird und die Rollen der vielen Institutionen im Leben dieser Familien allmählich überflüssig werden. Scholz, Michael (2005): Was können systemische Familientageskliniken in der Kinder- und Jugendpsychiatrie leisten? 23(3). In: ZSTB 23(3), S. 172-178. abstract: Es wird über die Einrichtung einer Familientagesklinik für emotional und sozial gestörte Kinder in Anlehnung an den Marlborough Family Service in London und über den originären Aufbau einer Familientagesklinik für anorektische Kinder und Jugendliche an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Dresden berichtet. Die Schwierigkeiten mit den notwendigen Rollenveränderungen aller Mitarbeiter, mit den Krankenkassen im Hinblick auf eine angemessene Finanzierung und die Ergebnisse werden dargestellt. Daraus werden Überlegungen abgeleitet, wie systemisches Arbeiten auf traditionellen Stationen integriert werden kann und welche Möglichkeiten sich in der Behandlung schwieriger Krankheitsbilder im Kindes- und Jugendalter ergeben. Behme-Matthiessen, Ulrike und Thomas Pletsch (2005): Themenorientierte Eltern-Kind-Gruppentherapie (TEK). In: ZSTB 23(3), S. 179-186. abstract: Dieser Artikel gibt einen Einblick in die theoretischen Grundlagen und die praktische Umsetzung der Themenorientierten Eltern-Kind-Gruppentherapie (TEK). Er beschreibt das Zusammenspiel systemischen und transaktionsanalytischen Denkens und Arbeitens in regelmäßig stattfindenden Gruppen mit mehreren Familien. In diesen Gruppen werden Themen der Bereiche „Familie und Identität“, „Stärken und Ressourcen“, „Vergangenheit und Zukunft“, „Kontakt und Kooperation“ und „Abschied und Neuanfang“ gestalterisch bearbeitet. Im Anschluss findet eine Reflexion im Elternkreis statt, bei der das Selbsthilfepotential der Eltern und ihre Kompetenz zur Lösungsfindung im Vordergrund stehen. TEK verbindet einen erlebnisorientierten Ansatz mit der Vermittlung von Handlungsstrategien, setzt dabei am Selbsthilfegedanken an und fördert so das Zutrauen der Familien in die eigenen Möglichkeiten. |
|
||||||||
Besuche seit dem 27.1.2005: 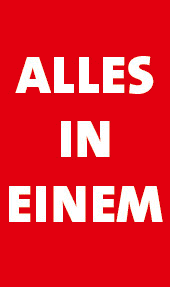  |
