 |
|
| Druckversion |
|
|
| Neuvorstellung | zur Übersicht | |||
|
02.04.2005 Heiko Kleve über Thomas Pfeffer |
||||
|
||||
| Carl-Auer-Verlag Heiko Kleve: Die soziologische Systemtheorie der Bielefelder Schule gilt vielerorts als empiriefeindlich. Das hat sicherlich etwas zu tun mit Niklas Luhmanns Abstinenz gegenüber empirischer Sozialforschung und mit seiner Position, dass die Soziologie zunächst eine brauchbare Gesellschaftstheorie benötige, vor deren Hintergrund erst die Vielzahl der gesammelten empirischen Daten plausibel interpretiert werden könne. Wer die soziologische Systemtheorie ernst nimmt, kann darüber hinaus nicht mehr daran glauben, dass empirische Forschung Daten erheben kann, die unabhängig von denen sind, die die Erhebung durchführen; vielmehr macht die Theorie selbstreferentieller Systeme sichtbar, dass Forscher genaugenommen selbst versteckte Ostereier finden, dass sie das mitproduzieren, was sie erforschen, und zwar aus zweierlei gründen: Erstens beeinflussen sie die Gegenstände ihrer Forschung durch den Vollzug des Forschungsprozesses (dies könnte man mit Werner Heisenberg „Unschärferelation“ nennen), und zweitens bestimmen ihre Beobachtungen (und nicht die Daten selbst, die es ohnehin nicht losgelöst von Beobachtern gibt), was innerhalb des Forschungsprozesses und während dessen Auswertung wie unterschieden und bezeichnet, genauer: beschrieben, erklärt und bewertet, kurz: interpretiert wird. Forschung ist demnach ein selbstreferentieller Akt. Wer nun allerdings behauptet, dass die soziologische Systemtheorie empirische Forschung ablehnt, der irrt. Freilich ist die Systemtheorie selbst eine empiriegesättigte Theorie, lassen sich ihre Theoreme durch Erfahrungen bestätigen. Nur dadurch ist es zu erklären, dass in vielen Praxen und Professionen das beobachtet werden kann, was Dirk Baecker formuliert, dass nämlich „gerade die hochgetriebenen Abstraktionen“ der Systemtheorie und verwandter Ansätze (z.B. Kybernetik zweiter Ordnung, Konstruktivismus, Differenztheorie) „als erstaunlich praxisnah erscheinen“. Dennoch gibt es noch nicht viele Arbeiten, die sich mit der Frage beschäftigen, welche Forschungsmethoden aus der Systemtheorie ableitbar sind bzw. welche sie präferiert und vorschlägt. Mit dem Buch von Thomas Pfeffer liegt eine solche Arbeit jetzt bereits in der 2. Auflage vor. Pfeffer geht von der Beobachtung aus, dass die soziologische Systemtheorie in soziologischen Methodenbüchern nur selten vorkommt, dass in solchen Publikationen nicht häufig auf die Theorie selbstreferentieller Systeme verwiesen wird, und er fragt sich, ob es überhaupt spezifische Forschungsmethoden gibt, die der soziologischen Systemtheorie entsprechen. Pfeffers These, die er in seinem Buch belegt, ist, dass die aus der systemischen Familientherapie kommende Interview- und Interventionstechnik des Zirkulären Fragens eine solche Forschungsmethode darstellen könnte. Nachdem Pfeffer die beschriebene Problemstellung, also das „Defizit an systemischen Forschungsmethoden in der Soziologie“ (S. 13) entfaltet, widmet er sich ausführlich dem Zirkulären Fragen. Er rekonstruiert mit Bezügen zur Systemtheorie und systemischen Familientherapie jenes Systemmodell, welches den Hintergrund bildet für das Zirkuläre Fragen, das im Ansatz der Mailänder Schule der systemischen Familientherapie entwickelt wurde. Dabei konstatiert Pfeffer erstaunliche Parallelen hinsichtlich der Konzipierung sozialer Systeme in der Luhmannschen Systemtheorie und der systemischen Familientherapie. Obwohl die Familientherapie nicht mit der theoretischen Radikalität vorgeht und den Menschen zur Umwelt von sozialen Kommunikationssystemen erklärt wie Luhmann, laufen ihre empirischen Beschreibungen aber auf praxisrelevante Konsequenzen hinaus, die der Luhmannschen Systemtheorie entsprechen: dass soziale Systeme durch kommunikative Ereignisse, durch Verhaltensweisen und Handlungen gebildet werden, die Strukturen, Prozesse und Muster von gegenseitigen, zirkulären Erwartungen voraussetzen und erzeugen. Gerade solche Erwartungsstrukturen, -prozesse und -muster expliziert das Zirkuläre Fragen. Trotz dieser gemeinsamen Konzeption sozialer Systeme, lassen sich Unterschiede zwischen der Systemtheorie und der Familientherapie konstatieren, die vor allem in den Erkenntnis- und Wirksamkeitsinteressen liegen. Während Luhmann insbesondere „Großsysteme“ beschrieben hat, so interessiert sich die systemische Therapie für die Beschreibung von „Kleinsystemen“, etwa von Familien. Gerade in diesem Kontext von stark personennahen Systemen ist das Zirkuläre Fragen nicht nur eine Interventionsmethode, sondern auch geeignet, um Interviews im Rahmen von empirischen Forschungsprojekten zu führen. Nachdem diese These plausibel geworden ist, diskutiert Pfeffer die unterschiedlichen Möglichkeiten des Zirkulären Fragens und die mit dieser Methode einher gehenden Haltungsmerkmale, die verbindlich sind sowohl für Therapeuten als auch für Forscher. Das Buch bietet eine sehr gute Einführung in die Methode des Zirkulären Fragens vor dem praktischen Hintergrund der systemischen Familientherapie und auf der Grundlage der abstrakten Systemtheorie. Überdies wird sichtbar, welche Erkenntnisgewinne Zirkuläre Fragen generieren können. Zirkuläre Fragen erlauben es, die verstrickten und nur selten offenen Strukturen, Muster und Prozesse des gegenseitigen Erwartens zu erheben, die soziale Systeme in ihrer Dynamik oder Statik prägen. Mit dem Zirkulären Fragen ist es möglich zu erklären, wie sich spezifische soziale Systeme (vor allem personennahe „Kleinsysteme“) strukturieren, wie sie immer wieder das werden, was sie aus der Beschreibungsposition ihrer jeweiligen Mitglieder jeweils sind. Pfeffers Buch ist für alle interessant und hilfreich, die insbesondere das systemtheoretische Kommunikationsmodell verstehen wollen und sich fragen, wie dies mit Empirie aufgefüllt werden kann. Die Empirie des Luhmannschen Kommunikationsbegriffs kann deutlich werden durch das aus der systemischen Familientherapie kommende Zirkuläre Fragen. Trotz der Plausibilität der Darstellungen Pfeffers und der Stringenz seiner Argumentation, dass das Zirkuläre Fragen als Forschungsmethode der Systemtheorie bewertet werden kann, weist das Buch eine Lücke auf: Es fehlt die Darstellung von konkreten beispielhaften Forschungsthemen, die mithilfe systemtheoretischen Forschens bearbeitet werden könnten. Wo bestehen die Defizite klassischer – sowohl quantitativer als auch qualitativer – Forschungsansätze, die durch eine systemtheoretische Forschung kompensiert werden könnten? Diese Frage wird nicht beantwortet. Der Leser kann hier nur Vermutungen anstellen und sich eingeladen fühlen, auf der Basis von Pfeffers These und Darstellung selbst an diesem Problem weiter zu denken. Dafür jedenfalls ist dieses Buch eine wertvolle und beachtenswerte Grundlage. Anmerkungen: Vgl. Armin Nassehi (1998): Gesellschaftstheorie und empirische Forschung. Über die „methodologischen Vorbemerkungen“ in Luhmanns Gesellschaftstheorie, in: Soziale Systeme, 1/1998, S. 199-206. Dirk Baecker (1994): Postheroisches Management. Ein Vademecum. Berlin: Merve, S. 13. Eine weitere Besprechung von Wolfgang Loth (mit freundlicher Genehmigung aus systema Heft 2, 2002)  Jenö Bango, Andras Karacsony (Hrsg.): Luhmanns Funktionssysteme in der Diskussion 150 Seiten - Carl-Auer-Systeme Verlag Erscheinungsdatum: Oktober 2001 ISBN: 3896703048 Preis: 16,00 € Wolfgang Loth, Bergisch Gladbach: Luhmann zieht Kreise. Die beiden hier vorgestellten Bücher dokumentieren dies auf zweifache Weise: Pfeffers Untersuchung zum „zirkulären Fragen“ als Ausdruck wechselseitiger Befruchtung von soziologischen Theorien und systemisch-therapeutischer Praxis, sowie der Kongressband von Bango und Karácsony als ein Ausdruck grenzüberschreitender Rezeption. Dabei macht Dirk Baecker in seinem Vorwort zum zweitgenannten Reader sofort darauf aufmerksam, dass es einen kontextfreien „Luhmann“ gar nicht gibt. Er skizziert unterschiedliche Schwerpunkte der Luhmann-Rezeption in unterschiedlichen Ländern, wie auch in unterschiedlichen Professionen innerhalb gleicher Sprachräume. Interessant (allerdings eher für Fortgeschrittene) ist daher die in diesem Band versammelte Multiperspektivität (ungarische und deutsche Wissenschaftler; Soziologie, Philosophie, Sozialarbeit). Die hier versammelten Beiträge diskutieren Einflüsse Luhmannscher Arbeiten auf gesamtgesellschaftliche, wirtschaftliche und juristische Fragestellungen, sowie auf Theorie und Praxis der Sozialarbeit. Bei aller Theorielastigkeit blitzt dennoch gelegentlich auf, was Luhmann für die Praxis bedeuten kann. Wer hätte etwa erwartet, dass Luhmann, dem der ahumane Touch anhaftet, wie dem Teufel die Furcht vor dem Weihwasser, auf eine Frage nach den praktischen Konsequenzen für die soziale Arbeit antwortete „In der Sozialarbeit muss man sich um ein weniger technisches, dafür um ein mehr menschliches Verständnis bemühen“ (zitiert von Bango, S.47). Im Unterschied zum Kongressreader konzentriert sich die Arbeit von Pfeffer auf ein Thema und entwickelt dabei einen durchgängig höheren Praxisbezug. Der Autor geht von der Unterscheidung aus, dass systemisch-familientherapeutische Praxis im Unterschied zur Soziologie „mit dem ‚zirkulären Fragen‘ über eine empirische Forschungsmethode verfügt, die sich (...) explizit auf systemtheoretische Konzepte beruft“ (S.66). Luhmanns Anweisung „Beobachte den Beobachter“ kann – auf den Punkt gebracht – als Bindeglied zwischen seinen theoriebegrifflichen Arbeiten und der Praxis des zirkulären Fragens verstanden werden. Pfeffer demonstriert dies in vielfältiger Weise, skizziert (auch für Einsteiger verständlich) die zentralen Elemente Luhmannscher Überlegungen zu sozialen Systemen, diskutiert (auch für Kenner nicht zu knapp) Prämissen und Vorgehen des zirkulären Fragens, arbeitet Querverbindungen heraus ohne Unterschiede zu verkleistern. Bedeutsame Unterschiede sieht Pfeffer insbesondere im angestrebten Abstraktionsgrad (Luhmann), bzw. in der angestrebten Adressatengenauigkeit (systemische Praxis). Er fasst allerdings seinen Eindruck so zusammen, die erkennbaren Unterschiede stünden „nicht in Widerspruch zu einander oder zu den gemeinsam verwendeten, systemtheoretischen Konzepten. Sie setzen an unterschiedlichen Abstraktionsniveaus an und demonstrieren damit die Spannweite der Beobachtungsmöglichkeiten, die durch diese Konzepte eröffnet wird“ (S.91). Von besonderer Bedeutung erscheint mir die übereinstimmende Konsequenz für das Bewerten professioneller sozialer Hilfen. „Fremdbeobachtung“ ist aus der Sicht Luhmannscher Theorienbildung „immer Beobachtung der eigenen Kommunikation mit dem anderen“ (S.132). Fragen der Selbstverantwortung und des Respekts ergeben sich daher wie von selbst. Eine übersichtliche Tabelle fasst systemische Haltungen, korrespondierende Selbstaufträge von InterviewerInnen, sowie entsprechend förderliche, bzw. vermeidende Fragen zusammen. Fazit: Nicht nur für Luhmannfreaks interessant, sondern auch für alle, die ihre Praxisüberlegungen mit Hilfe von Aussenperspektiven vertiefen möchten. Weitere Rezension zum Buch von Pfeffer: Hauke Wandhoff in "IASLonline": "Zirkuläres Fragen" als Methode für eine empiriefreie Theorie? |
||||
|
|||||
|
Besuche seit dem 27.1.2005: 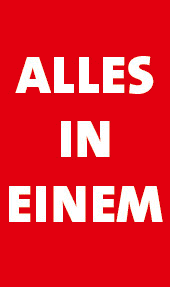  |

