 |
| Druckversion |
|
|
| systemagazin special: "Das erste Mal" |
| Susanne Hilbig: Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, doch vor allem das Durchhalten wird belohnt Mitte der 80er Jahre habe ich zum ersten Mal hinter einer Einwegscheibe gesessen. Als Praktikantin beobachtete ich in der Abteilung Psychosomatik der Medizinischen Hochschule Hannover den Verlauf einer systemischen Familientherapie „di Milanese“. Damit eröffnete sich eine neue Welt und – damals ahnte ich es noch nicht – eine Berufsperspektive mit Folgen. Ich konnte es kaum glauben, war fasziniert, geradezu beflügelt zu erleben, wie in Teamreflektionen und praktikumsbegleitenden Balintgruppen meine Ideen und Eindrücke ebenso wohlwollend aufgenommen wurden, wie die Sichtweisen der anwesenden Profis. Klienten wurden hier nicht als krank oder defizitär gesehen, sondern – so schien es - als verstrickt in beengten Sichtweisen oder Beziehungsgeflechten, als Menschen, die den Zugang zu ihren (Lösungs-) Ressourcen aus dem Blick verloren hatten. Die Therapeuten und Therapeutinnen agierten als respekt- und humorvolle „Anreger“ manchmal auch als in die „Problemsuppe spuckende Verstörer“, ohne eine Spur von Besserwisserei und Überheblichkeit. Diese professionelle Haltung hat mich nachdrücklich geprägt. Ein Jahr später gehörte ich in eben dieser Abteilung dem familientherapeutischen Team eines Forschungsprojektes an, das den Vergleich ambulanter systemischer Therapie gegenüber stationärer analytischer Therapie bei Bulimia nervosa zum Gegenstand hatte. Mittlerweile in Ausbildung zur systemischen Therapeutin und Mitarbeiterin in einer Beratungsstelle hatte ich die einmalige Gelegenheit systemische Theorie in der Praxis auszuprobieren und zu überprüfen. Es dürfte kaum verwundern, dass ich zu Beginn meiner Laufbahn mich geradezu außerstande sah, je das Niveau der bewunderten Vorbilder und Lehrer meiner „frühen Jahre“ Weber, Schmidt, Simon, Retzer, Stierlin, Deissler, später auch Schweitzer, Boscolo und Cecchin, Imber-Black, Penn oder Welter-Enderlin zu erreichen. (und mit ihnen sind bei weitem nicht alle wichtigen Inspiratoren meiner therapeutischen Entwicklung benannt). Aber, ich war (noch) jung und naiv genug, um mich zu sehr darum zu scheren. Eines war mir damals sonnenklar: Ich wollte Teil dieser geistvollen Welt sein. Es drängte mich zunächst nicht so sehr, Techniken zu erlernen, vielmehr hatte ich den Wunsch, zu denen zu gehören, die so virtuos und elegant mit Wirklichkeiten spielen konnten. Wenn ich es recht bedenke, habe ich vorwiegend von den Haltungen meiner Lehrer und Lehrerinnen gelernt. Das, was durch die Fragen, die gestellt wurden, durch die Interventionen, die Geschichten und Metaphern, die sie benutzten, hindurch schien, ihr Menschen- und Weltbild, das Spiel mit Möglich- und Wirklichkeiten war es, was mich begeisterte und zur Nachahmung drängte. Be-Geisterung war es, die mich antrieb. Es war beinahe so wie eine Liebesgeschichte. Wir waren alle sehr euphorisiert. Die offizielle „Genehmigung“ , die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten zu können, - ohne Wahrheitsanspruch - eine große Entlastung und heimliche Bestätigung. Schließlich entstammte ich als Kind der 60er und weltkriegsgeprägter Eltern einer ausgesprochen „wahrheitsbetonten“, autoritären, oft polarisierenden Kultur. Ich erinnere noch sehr genau, wie mich die Auflösung der Konstruktion des „Entweder-oder“ in das versöhnliche „Sowohl-als-auch“ geradewegs zu Tränen gerührt hat. Die Peinlichkeit der stokeligen Fragen, die mir – als Konsequenz meines kühnen Entschlusses, gezwungen etwas zu tun – über die Lippen kamen, habe ich irgendwie überstanden. Ich winde mich aber heute noch ein wenig, wenn ich daran denke. Und es ging ja keineswegs schnell vorbei. Es gibt nicht nur den einen ersten Fall sondern viele! Jahre des Studiums und des tastenden Begreifens systemischer Theorie und den sich daraus ergebenden Handlungsoptionen. Kein geringer Teil an Selbsterfahrung – und hier war für mich auch gerade der psychoanalytische „Blick“ bis heute unschätzbar wertvoll -, viele Klienten und Klientinnen, die ich in all den Jahren begleiten durfte, Kollegen und Kolleginnen, später auch Trainees haben mich gelehrt, irritiert, gestärkt, kritisiert, unterstützt, und etlichen Tests und Prüfungen unterzogen. Gelernt habe eines ganz besonders: zu beobachten. Das ist heute vielleicht eine meiner besseren Fähigkeiten: Das präzise Beobachten der Kommunikationen meiner Mitmenschen eingeschlossen meiner eigenen (inneren wie geäußerten) und diese Beobachtungen zu nutzen, das ist eine besondere Ressource. Dabei ist mir die Konstruktivität meiner Wahrnehmungen (meist) bewusst. Zugegeben hat aber auch und gerade diese Entwicklung eine ganze Weile gedauert. Mit anderen Worten, es hat gedauert, bis ich über genügend Selbstbewusstsein und Erfahrung verfügte, eine meiner Ideen als eine von vielen anderen Möglichkeiten anzuerkennen und damit die Unsicherheit und das Risiko der Kommunikation und der Begegnung voll anzuerkennen. Die Unsicherheit des Nicht-Wissens, in der Anfangsphase ein überaus unangenehmer Zustand, den ich möglichst „unbemerkt“ und schnell in Richtung Wissen und Durchblick verändern wollte; heute kann das Quelle magischer Momente der Einsicht und Veränderung sein. Dabei spielt auf Erfahrung basierendes Vertrauen eine große Rolle, Vertrauen in meine Kompetenz ebenso, wie in die Kompetenz meiner Klienten. Und was hat mich bis heute – 20 Jahre später - dabei gehalten? Meine unverminderte Lust in den sich fortentwickelnden Denkwelten systemischer Theorien herumzugeistern und meine Neugier auf die Menschen und ihre Motive und Geschichten. Ich finde immer noch, immer mehr, dass Menschen ausgesprochen interessante Leute sind, wenn man sie nur lässt. |
|
||||||||
Besuche seit dem 27.1.2005: 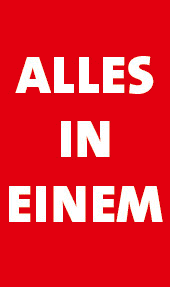  |
