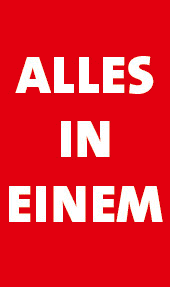Copyright © 2013
levold system design
Alle Rechte vorbehalten.
|
|
|
systemagazin special: "Das erste Mal"
|
Fritz B. Simon: Natürlich schreibe ich nicht über das erste Mal
Natürlich schreibe ich nicht über das erste Mal. Eine problematische Formulierung, deren Konnotationen mir im Zusammenhang mit Therapie nicht wirklich gut gefallen (obwohl ich darüber sicher noch einmal nachdenken sollte, denn therapeutische Beziehungen sind ja irgendwie immer eine Art von Intimbeziehungen).
Aber ich kann über einen meiner ersten Patienten nach meinem therapeutischen Saulus-Paulus-Erleben sprechen. Schon sehr wenige Tage, nachdem ich begonnen hatte, in der Psychiatrie als Stationsarzt zu arbeiten (wie damals üblich: ohne jede psychotherapeutische Ausbildung), fing ich an, nach einem theoretischen Modell zu suchen, dass mir nicht nur Beschreibungen der Psychopathologie von Patienten und – in einigen wenigen Fällen – auch Erklärungen für deren auffallendes und als symptomatisch bewertetes Verhalten lieferte, sondern auch einen Rahmen, anhand dessen ich zwischen sinnvollen (therapeutisch nützlichen) und nicht sinnvollen Interventionen meinerseits unterscheiden könnte. Irgendjemand hatte mir damals – es ist mehr als 30 Jahre her – das Buch „Lösungen“ von Paul Watzlawick und seinen Kollegen vom Mental Research Institute in Palo Alto geschenkt. Etwa nach der Hälfte der Lektüre begann ich nach dem Modell zu arbeiten – und eines meiner ersten „Opfer“ war der Patient, über dessen gescheiterte Therapie ich hier berichten will.
Es handelte sich um einen jungen Mann, eher ein großer, lieber Junge. An das Alter erinnere ich mich nicht mehr genau, er muss etwa 18, 19 Jahre alt gewesen sein, ich war 26. Er litt unter einer extrem starken Zwangssymptomatik. Seine Eltern und seine Geschwister kümmerten sich in einer unvorstellbar aufopfernden Weise um ihn, was die Symptomatik tragischerweise nicht verbesserte, sondern – so zumindest damals meine Einschätzung – eher verschlimmerte. Er wurde der Patient, an dem ich (besser: wir – denn wir waren ein Team aus drei Personen, die hier herumexperimentierten und –dilettierten)zum ersten Mal (also doch!) mit der Methode der „paradoxen Intention“ arbeitete. Ich gab ihm alle möglichen unmöglichen Aufträge, die er nach bestem Wissen und Gewissen (und daran mangelte es bei ihm wirklich nicht) zu realisieren versuchte. Wochenlang „kämpften“ wir miteinander (es war wohl wirklich ein Kampf), und wir verloren beide: Er behielt seine Symptome oder schaffte sich andere an. Und auch die Eltern und Geschwister schafften es nicht, eine klarere Grenze zwischen und ihren Sohn bzw. Bruder zu ziehen, es kam zu keiner Entwicklung (hier als Gegensatz zu Verwicklung zu verstehen) der Beziehung…
Ich weiß nicht mehr, wie wir damals auseinander gegangen sind. Für mich war und ist der Gedanke an diesen Patienten immer mit dem Gefühl einer Niederlage und des Versagens verbunden. Habe ich ihn damals als Versuchskaninchen verwendet? Sicher! Bin ich meinem therapeutischen Größenwahn erlegen? Sicher! Hätte ich etwas Anderes, Verantwortungsvolleres tun können? Vielleicht (auch wenn ich nicht wusste, was das hätte sein können – außer ihn mit Medikamenten voll zu stopfen, was auch damals schon eine Option war…). Würde ich heute etwas anders machen? Vielleicht,wahrscheinlich…
Vor einigen Monaten erhielt ich einen Brief der Mutter des Patienten. Er hatte sich gerade – etwa 30 Jahre nach der „Behandlung“ bei mir umgebracht. Seine Patientenkarriere war weiter gegangen, unterschiedliche Therapie- und Rehabilitationsverfahren waren versucht worden, selbstverständlich auch die Verordnung von Medikamenten (ohne die ging es zuletzt gar nicht mehr). Nichts hat nachhaltig geholfen. So bereitete er schließlich seiner unglücklichen Existenz ein Ende.
Was mich ein wenig mit meiner eigenen Arbeit versöhnt hat, waren die Worte der Mutter, die in einem Telefongespräch sinngemäß sagte, ich sei derjenige gewesen, der sich wohl am meisten auf ihren Sohn eingelassen hätte und ihn – verglichen mit den Psychiatern und Psychotherapeuten, die nachher kamen – am meisten als Mensch gesehen hätte.
Vielleicht ist das ja das, was der Anfänger seinen Patienten und Patientinnen geben kann: den Mangel an fachlicher Distanz, die Risikobereitschaft, das Engagement, die Leidenschaft, das Kämpfen mit ihm oder ihr – die Bereitschaft, ihn oder sie entscheiden zu lassen, ob man als Therapeut erfolgreich ist…
|
|
|