 |
| Druckversion |
|
|
| revue für postheroisches Management - Heft 7 - 2010 |
Heft 6 2010 - Heft 7 - 2010 - Übersicht Krusche, Bernhard & Torsten Groth (2010): Editorial: Systemische Risiken. In: revue für postheroisches management 7 S. 3-5. abstract: Die Verwendung des Begriffs des systemischen Risikos hat durch die Finanzkrise eine Eigendynamik entwickelt, die bei näherer Betrachtung stutzen lässt. Skepsis ist angebracht, wenn ein Begriff sich modisch gibt und das Feuilleton der Tagespresse erobert. Statt in den aufgeregten Tonfall (anklagend, verteidigend, beschwörend, resignierend) einzustimmen, der sich rund um diese Begrifflichkeit etabliert hat, vertieft die Revue für postheroisches Management die Diskussion und überführt sie aus der Finanzwelt in weitere gesellschaftliche Teilbereiche. Was heißt es für Management und Beratung, in einer Gesellschaft des unvermeidlichen Risikos zu agieren? Munter, Werner & Falk Busse (2010): Interview mit Werner Munter: Vom Wert des differenzierten Beurteilens und schablonenartigen Entscheidens. In: revue für postheroisches management 7 S. 8-13. abstract: Um 50 Prozent sind die Opferzahlen bei Lawinenunglücken seit den 80er Jahren zurückgegangen. Dieser Erfolg geht zu einem großen Teil auf die Arbeit von Werner Munter zurück, dessen Werdegang vom Sicherheitsgaranten zum Unsicherheitsexperten als exemplarisch für Risikomanagement – auch außerhalb der Berge – gelten kann. Gerne zitiert der Bergführer Nietzsche und wirbt dafür, »die Wahrheit auf eine kluge Weise misszuverstehen, zum Zwecke des Überlebens«. Falk Busse im Gespräch mit dem Lawinenforscher. Perrow, Charles (2010): Disasters Evermore? Reducing our Vulnerabilities to Natural, Industrial, and Terrorist Disasters. In: revue für postheroisches management 7 S. 14-25. abstract: Die Krise ist vorbei. Die Menschen in Deutschland und Europa kaufen und konsumieren wie seit Jahren nicht mehr, die Arbeitslosenzahlen sinken und auch die Auftragsbücher der Wirtschaft füllen sich zusehends. Die westliche Welt erhebt sich – von der Krise geläutert – wie Phönix aus der Asche. Nein, dieselben Fehler wird man nicht wieder begehen. Ja, natürlich hat man die Dinge wieder im Griff. Man wird aus den Erfahrungen lernen und damit zukünftige Krisen verhindern, selbstverständlich. War’s das? Wohl kaum. Nach der Krise ist vor der Krise. Den Teufel an die Wand malen muss man zwar nicht – aber es bedarf keiner hellseherischen Fähigkeiten, um eine Idee davon zu bekommen, dass dies nicht die letzte (Wirtschafts-)Krise der modernen Welt war; wenn sie denn überhaupt schon der Vergangenheit zurechenbar ist. Doch was folgt aus dieser Einsicht in die Gewissheit einer solchen Prognose? Für den Katastrophenforscher Charles Perrow liegen die Dinge denkbar einfach. Wenn wir nicht in der Lage sind, Krisen und Katastrophen zu verhindern, dann müssen wir einen gesunden Pragmatismus walten lassen und verantwortungsvoll für den nächsten Zwischenfall vorsorgen, um den möglichen Schaden schon jetzt zu begrenzen. Wir möchten Sie daher einladen, mit dem Schlimmsten zu rechnen. Nehmen Sie sich ein Beispiel an der Leidenschaft Perrows, mit der er im folgendem Artikel den leichtfertigen Umgang mit Gefahrenpotenzialen markiert und interessante Konzepte zu deren Begrenzung entwirft. Baecker, Dörte (2010): Körper Raum Leere. Korrelation. In: revue für postheroisches management 7 S. 26-29. abstract: »Der plastische Körper verkörpert etwas. Verkörpert er den Raum? Ist die Plastik eine Besitzergreifung vom Raum, eine Beherrschung des Raumes? Entspricht die Plastik damit der technisch-wissenschaftlichen Eroberung des Raumes?« (Martin Heidegger). Die Inszenierung mit geometrischen Körpern wie dem Kubus, der Kugel und dem Kegel, ausgeleuchtet auf unterschiedliche Weise, bringt Durchlässigkeit, Brechung, Doppelebenen des Glases hervor. Es entstehen Räume. Licht und Schatten werden gleichwertig. Es findet eine Schaffung des Raums durch Verwischung der Ebenen statt. Die Transparenz des Glases dient als Mittel zum Zweck. Es interessiert nicht, »hindurch« zu schauen. Der Blick wird aufgehalten, zurückgeworfen und gelenkt auf sich selbst. Durch das Licht verändert das Glas seine Eigenschaften, seine Fähigkeit der Lichtdurchlässigkeit. Es wird stofflich. Es ist meine Absicht, dem Willen zur Komposition zu widersprechen. Zu komponieren und gleichzeitig einen kreativen Prozess in Gang zu setzen, der sich fast verselbstständigt. Glas ist nicht mehr Glas, Transparenz wird zur Opazität, Licht und Schatten verlieren ihren antinomischen Charakter. »Die Bemerkungen zur Kunst, zum Raum, zum Ineinanderspiel beider bleiben Fragen, auch wenn sie in der Form von Behauptungen sprechen. Sie beschränken sich auf die bildende Kunst innerhalb ihrer auf die Plastik. Die plastischen Gebilde sind Körper. Ihre Masse, aus verschiedenen Stoffen bestehend, ist vielfältig gestaltet. Das Gestalten geschieht im Abgrenzen als Ein- und Ausgrenzen. Hier kommt der Raum ins Spiel. Er wird vom plastischen Gebilde besetzt, als geschlossenes, durchbrochenes und leeres Volumen geprägt. Bekannte Sachverhalte und dennoch rätselhaft.« (Martin Heidegger). Mittels der Fotografie Rätselhaftigkeit, Unerwartetes zum Ausdruck bringen, Raum für Leere zu lassen ist mein Versuch. Die Fotografie malerisch wirken zu lassen, d.h. nicht bis ins Detail stilistisch auszuformen soll diesem Ziel näher kommen. Baecker, Dirk (2010): Wie in einer Krise die Gesellschaft funktioniert. In: revue für postheroisches management 7 S. 30-43. abstract: Was ist eine Krise? Eine Krise ist ein Moment, in dem eine Entscheidung getroffen werden muss. »Krisis« nannten die Griechen jene endgültige und meist unwiderrufliche Entscheidung, nach der, einmal getroffen, das Schicksal seinen Lauf nehmen konnte. In einer Krise geht es um Erfolg oder Scheitern, Recht oder Unrecht, Tod oder Leben. Das heißt natürlich, dass man Krisen eher zu vermeiden hat. Wer trifft schon gerne eine unwi- derrufliche Entscheidung? Nur Helden und solche, die es dann werden müssen, müssen solche Entscheidungen treffen. Alle anderen, klüger als sie, schauen ihnen dabei zu, wie sie entweder triumphieren oder untergehen. Meistens gehen sie unter, denn der Triumph ruft den Neid der Götter auf den Plan, die dann ihrerseits dem Schicksal eine neue Wendung geben. Sornette, Didier (2010): Risk Management and Governance Lessons and Prospects From the 2007–20xx Crisis. In: revue für postheroisches management 7 S. 44-53. abstract: A financial crisis of enormous proportions that started in 2007 is still echoing in the global economy, with aftershocks that are cascading and threatening to be larger than the previous main shocks. In other words, the crisis is far from having ended. Here, we weave a network of insights and lessons for better integrative dynamic risk management. Stahel, Fritz (2010): Kleine statt große Blasen platzen lassen. In: revue für postheroisches management 7 S. 54-59. abstract: Wir schreiben den 21. April 2006. Die Sonne scheint und die Temperaturen machen Lust auf Sommer. Eine laue Brise geht, die Welt ist in Ordnung. Gerade hat der Internationale Währungsfonds seinen Global Financial Stability Report veröffentlicht. Auch hier gute Nachrichten: Die globale Finanzwirtschaft sei gestärkt aus der Krise 2000/2001 hervorgegangen. Die Inflation sei gering und das globale Wachstum solide. Nur das Subprime-Segment des amerikanischen Immobilienmarktes macht etwas Sorgen, doch da werde sich der Markt selbst helfen. Registriert wird auch rapides Wachstum bei den Kredit-Derivaten, insbesondere bei den komplexeren Produkten. Insgesamt eine gute Sache, gelingt es damit doch, das Risiko der Banken und des gesamten Finanzsystems auf mehrere Schultern zu verteilen. Insgesamt wisse man noch zu wenig über diesen Markt, weil ihn noch kein ernsthafter, längerer Abschwung »getestet« habe. Hier gibt es Nachholbedarf: Der IWF solle weiterhin in Zusammenarbeit mit anderen nationalen und internationalen Finanzinstitutionen die Marktentwicklungen aus einer globalen Stabilitäts-Perspektive im Blick behalten, insbesondere unter dem Aspekt der Milderung systemischer Risiken. Soweit die heile Welt der Finanzmärkte im Jahre 2006. Kalkulierbare und damit beherrschbare Risiken, denen das Versprechen großartiger Gewinne entgegensteht. No risk, no fun. Heute diskutieren wir darüber, ob der Kapitalismus in der uns vertrauten Form versagt hat, ob also ein global dereguliertes Finanzsystem ohne politisches Gegengewicht überhaupt durchschaubar, geschweige denn regulierbar ist. Doch bevor wir uns einer eher fatalistischen Sicht auf die Dinge hingeben, müssen wir festhalten, dass das Netz von Aufsichts- und Regulierungsbehörden in seiner Effektivität stark ausbaufähig ist; dies lehrt zumindest das Beispiel des IWF. Krisenprävention ist zwar anspruchsvoll, doch durchaus möglich. So argumentiert jedenfalls Fritz Stahel in einem bemerkenswert kühlen Beitrag, den wir mit freundlicher Genehmigung der Neuen Zürcher Zeitung an dieser Stelle gern noch einmal abdrucken. Steele-Perkins, Chris (2010): Mount Fuji. Ein Bilderreigen zur Nachhaltigkeit in Zeiten des Risikos - Der Prix Pictet. In: revue für postheroisches management 7 S. 60-61. abstract: Die traditionsreiche Privatbank Pictet & Cie beschäftigt sich seit Langem mit dem Thema Nachhaltigkeit und hat hierzu 2008 zusammen mit der Financial Times den jährlichen Prix Pictet geschaffen – einen weltweit angesehenen Preis für Fotografie und Nachhaltigkeit. Wir präsentieren Ihnen ausgewählte Fotografien vom Magnum-Fotografen Chris Steele-Perkins, in denen er mit der Abbildung des Fuji eine lange Tradition japanischer Kunst aufgreift. Der Künstler selbst versteht seine Bilder »as a commentary on modern Japan and the erosion of natural beauty in the name of progress«. Wallek, Marlies & Bernhard Krusche (2010): No risk, much fun? Zur Frage des Risikomanagements in Telekommunikationsunternehmen. Ein Interview mit Marlis Wallek. In: revue für postheroisches management 7 S. 62-65. abstract: Mit über 16.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und einem Umsatz von 4,8 Milliarden Euro in 2009 ist die Telekom Austria Group einer der größten Anbieter von Telekommunikationsleistungen in Südosteuropa. In Österreich ist die A1 Telekom Austria AG nicht zuletzt durch den Zusammenschluss von Festnetz und Mobilfunk der Marktführer im Telekommunikationsbereich. Gegründet im Jahr 1887 als staatliche Post- und Telegrafenverwaltung, hat der Konzern in den letzten Jahren einen radikalen Wandel zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen vollzogen. Den turbulenten Entwicklungen in der gesamten Telekommunikationsbranche begegnet das Unternehmen immer wieder mit einem Mix aus Kostendisziplin und einer Vielzahl von Innovationen. Dass dabei ein vorausschauendes Risikomanagement eine herausragende Rolle spielt, versteht sich von selbst. Bernhard Krusche im Gespräch mit Marlis Wallek, der für das Risikomanagement verantwortlichen Analystin des Konzerns. Ortmann, Günther (2010): Die (Ohn-)Macht der Moral und das Driften der Systeme: Der Fall der Finanzkrise. In: revue für postheroisches management 7 S. 66-73. abstract: Die Moderne, die immer mehr von Vergangenheits- auf Zukunftsreferenz umgestellt hat, ist inzwischen unterwegs, diese ihre Zukunftsreferenz zu einer Art faustischem Pakt auszubauen – zu einer Art Wette, deren Einsatz die ganze Welt ist: Wetten, dass der Immobilienhandel, das Finanzsystem, die Wirtschaft grosso modo krisenfrei funktioniert, und wenn wir noch so hohe Wechsel auf die Zukunft ziehen? Das ist selbstverständlich eine Fiktion. Jede, jeder der Beteiligten kann es besser wissen, und besonders die Finanzexperten, die Banker, die Ratingagenturen e tutti quanti konnten und mussten es wissen. Viele haben es auch gewusst, zum Beispiel George Soros, wie etwa in einem Interview für den SPIEGEL (47/2006, S. 94) nachzulesen ist, mit Hinweis auf die Immobilien- und die Private-Equity-Blase. Schneeballsysteme funktionieren bekanntlich trotzdem – so lange es gut geht. Was damit in Begriffen der Zeit gesagt ist, lässt sich auch in Begriffen der Moralität formulieren. Wetten, muss es dann heißen, dass unsere Systeme auch, und besser, ohne Moral funktionieren – wenn wir sie ihren Funktionserfordernissen und Selbstregulationsmechanismen (und dem Nutzenstreben der Akteure) überlassen? Das nenne ich die große Wette der funktionalistischen Moderne (die, versteht sich, auch eine Moral enthält). Golz, Armin & Falk Busse (2010): Langfristige Unternehmenspolitik bedeutet vernünftiges Risikomanagement. Interview mit Armin Golz. In: revue für postheroisches management 7 S. 74-78. abstract: Bosch Rexroth ist Teil des Unternehmensbereichs Industrietechnologie der Robert Bosch GmbH. Die Unternehmung ist weltweit tonangebend in der Antriebs- und Steuerungstechnologie und fasst alle Antriebstechniken – Hydraulik, Pneumatik, elektrische und mechanische Antriebe – mit den dazugehörigen Steuerungen und dem Service in einem Konzern zusammen. Die 33.000 Mitarbeiter des Konzerns sind auf 80 Länder dieser Welt verteilt. Davon arbeiten 850 bei Bosch Rexroth B. V. in den Niederlanden mit dem Hauptsitz in Boxtel. Bosch Rexroth B. V. ist für den Vertrieb in den Niederlanden zuständig und darüber hinaus auf die Produktion von Großzylindern und die Realisierung von Kundengroßprojekten, wie z. B. Marine- und Offshoreanwendungen, Motionsys- teme und Wellengeneratoren spezialisiert. Falk Busse im Gespräch mit Armin Golz, Chief Financial Officer von Bosch Rexroth B. V. Willke, Helmut (2010): Systemische Risiken und cooler Kapitalismus. In: revue für postheroisches management 7 S. 80-87. abstract: Das Finanzsystem ist das Epizentrum des Kapitalismus, so viel lehrt die globale Krise. In der globalisierten Welt kann das Finanzkapital nicht nur das Schicksal von Milliarden Menschen bestimmen, sondern auch das Schicksal des Kapitalismus selbst. Folgerichtig gehört es zum neuen Stil der Kapitalismuskritik, das Finanzsystem zum eigentlichen Schurken zu erklären. Aber ein paar Schurken im System machen noch nicht das System zum Schurken. Alle Fundamentalkritik am Kapitalismus verkennt, dass wir nichts Besseres haben. Wenn nach dem Zusammenbruch des Sozialismus auch der Kapitalismus scheitern würde, was bliebe dann? Es geht also, trotz globaler Wirtschaftskrise, nicht um eine Alternative zum Kapitalismus, sondern um eine bessere Alternative des Kapitalismus, im Kern um eine Variante des Kapitalismus, die den Herausforderungen globaler Märkte und nationaler Demokratie gewachsen ist. Wimmer, Rudolf (2010): Systemische Organisationsberatung – jenseits von Fach- und Prozessberatung. In: revue für postheroisches management 7 S. 88-103. abstract: Die Jahrzehnte lang stabile Aufteilung der Beratungsbranche in die expertenorientierte Fachberatung – dominiert von den weltweit operierenden großen Beratungsunternehmen – und in die auf gelingende Kommunikation spezialisierte Prozessberatung ist in Bewegung gekommen. Mehr als vier Jahrzehnte hindurch haben kontinuierliche Wachstumsraten das Selbstverständnis in diesen professionellen Lagern und ihre wechselseitige Abgrenzung, bisweilen auch Abwertung bestätigt. Die Anzeichen verstärken sich, dass diese stabile Branchensegmentierung und ihre bestimmenden Grenzen im Begriff sind, sich aufzuweichen. Als prominentes Beispiel dafür kann die intensive Diskussion um den Sinn und Zweck der Komplementärberatung dienen (Königswieser, Lang, Wimmer 2009). Die Bemühungen nehmen deutlich zu, diese beiden professionellen Welten in ihren jeweiligen Lösungsrepertoires miteinander zu verbinden (Handler 2007). Offensichtlich wächst bei immer mehr Kunden ein grundsätzliches Unbehagen an jenen eingeführten Beratungsdienstleistungen, die in ihrer bisherigen Ausprägung aus dem Selbstverständnis der tradierten Arbeitsteilung von expertenorientierter Fach- und Prozessberatung resultieren (Gömmel 2010). Baecker, Dirk (2010): Management für Fortgeschrittene: Auf nach China. In: revue für postheroisches management 7 S. 104-107 Priddat, Birger P. (2010): Wozu Wirtschaft: Systemrisiko Vertrauen. In: revue für postheroisches management 7 S. 108-111 Simon, Fritz B. (2010): Hollywood: Lohn der Angst. In: revue für postheroisches management 7 S. 112-115 Karafillidis, Athanasios (2010): Risiken, ihre Organisation und die Technik ihrer Vermeidung. In: revue für postheroisches management 7 S. 116-119. abstract: War die Entscheidung für das Großprojekt »Stuttgart 21« riskant? Natürlich war sie riskant. Zumindest lässt sich kaum leugnen, dass es mittlerweile zahlreiche Beobachter gibt, die es so sehen – und nur das kann bei der Einschätzung, ob etwas riskant ist oder nicht, maßgebend sein. Dass man ein Risiko eingegangen ist, scheint nun offensichtlich, denn man hatte den Kostenaufwand falsch eingeschätzt, das Vertrauen in politische Entscheidungsverfahren überschätzt und das Engagement und Mobilisierungspotenzial der »bürgerlichen Mitte« unterschätzt. Nun beklagt man von allen Seiten die Schäden, die vor allem als zukünftig zu erwartende Verluste markiert werden, aber schon jetzt Konsequenzen zeitigen, obwohl über ihr Eintreten keinerlei Sicherheit bestehen kann: Man rechnet mit Verlust von Wählerstimmen, mit Imageverlust, mit einem Verlust von Standortattraktivität, mit Gewinnverlust oder Ver- trauensverlust. Aber natürlich sollte man dabei nicht außer Acht lassen, dass andere Beobachter gerade des- halb auch Gewinne wittern können. Mit eigenen wie fremden Risiken lässt sich spekulieren, man kann Wetten auf sie abschließen, wie sich an der Finanzwelt und ihren Produkten besonders gut studieren lässt. |
|
||||||||
Besuche seit dem 27.1.2005: 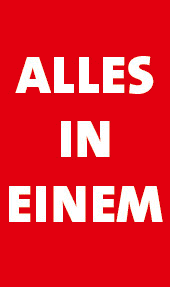  |
