 |
|
| Druckversion |
|
|
| Neuvorstellung | zur Übersicht | |||
|
15.02.2006 Peter Fonagy, György Gergely, Elliott L. Jurist, Mary Target: Affektregulierung, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst |
||||
|
||||
| Klett-Cotta Verlag Vorbemerkung: Dies ist keine Rezension im gewohnten Sinne, sondern ein Essay, der den systemischen LeserInnen u.a. das Konzept der Mentalisierung näher bringen soll, welches im Buches von Fonagy et al. entfaltet wird, und darüber hinaus auch andere aktuelle Arbeiten von Bateman & Fonagy sowie Martin Dornes und Lotte Köhler mit einbezieht (T.L.) Michael B. Buchholz, Göttingen: Mentalisierung und Trauma – Ein kleiner Überblick über neuere psychoanalytische Texte, die Systemische Therapeuten interessieren könnten Franny, die Schwester des Ich-Erzählers in John Irvings bärenstarkem Roman „Das Hotel New Hampshire“ wird als 15jähriges Mädchen von drei Sportler-Jungs vergewaltigt, ein „Bandenstich“, wie es in der deutschen Übersetzung heißt. An der Schule gibt es einen Schwarzen namens Junior Jones, der an der Schule, die solche Vorfälle gerne vertuscht, den „schwarzen Arm des Gesetzes“ als Selbsthilfe organisiert, seit auch seine Schwester einmal vergewaltigt wurde. Junior Jones trägt Franny auf seinen Armen ins Haus. Ich zitiere ein paar Zeilen aus dem Roman: Franny weinte und weinte und Junior sagte: „Hör mal, du bist ein gutes Mädchen, ich kann das sehr gut beurteilen.“ Aber Franny weinte weiter. „He, paß auf“, sagte Junior Jones. „Ich will dir mal was sagen. Wenn dich jemand anfasst und du willst nicht angefasst werden, dann wirst du nicht wirklich angefasst . du musst mir das glauben. Das bist dann gar nicht du, was die da anfassen; so erwischen sie dich nicht wirklich, verstehst du? Du hast immer noch dich in dir drin. Keiner hat dich angefasst – nicht wirklich. Du bist ein wirklich gutes Mädchen, glaubst du mir das? Du hast immer noch dich in dir drin, glaubst du mir das?“. Dieser Rat zu depersonalisieren, wird für Franny lebensrettend über lange Seiten des Buches. Die, die Franny „verprügelt“ haben, wie man sich mangels Hoffnung auf Bestrafung der Täter sprachregelnd gegenüber Eltern und anderen einigt, werden nun ihrerseits gepackt und doch noch von der Schule geschasst. Das beruhigt das aufgewühlte Gerechtigkeitsgefühl. Franny und ihr schwarzer Retter befreunden sich etwas, es gibt eine gewisse Zeit später dann eine Party, zu der auch die vergewaltigte Schwester von Junior Jones miteingeladen wird. Sie soll John, den Ich-Erzähler, auf der Party begleiten; er ist 14 Jahre alt. „Ist es die Schwester, die vergewaltigt worden ist?“, fragte ich Franny unvermittelt. „Ich meine, welche Schwester bringt Junior mit?“. Aus der Art, wie Franny mich ansah, schloß ich, daß auch diese Frage Jahre zwischen uns legte. „Er hat nur eine Schwester“, sagte Franny und blickte mir direkt in die Augen. „Macht es dir etwas aus, daß sie vergewaltigt worden ist?“ Natürlich wusste ich nicht, was ich sagen sollte: Daß es mir etwas ausmachte? Daß man mit einer Vergewaltigten nicht über das Thema Vergewaltigung sprach, während man mit Nicht-Vergewaltigten sofort eine Diskussion darüber begann? Daß man nach den bleibenden Narben in der Persönlichkeit suchte oder daß man nicht danach suchte? Daß man bleibende Narben in der Persönlichkeit annahm und mit der Person wie mit einem Invaliden sprach? (Und wie sprach man mit einem Invaliden?) Daß es mir nichts ausmachte? Aber es machte mir etwas aus. Ich wusste auch, warum. Ich war vierzehn. In meiner Unerfahrenheit (und in Bezug auf Vergewaltigung würde ich immer unerfahren bleiben) stellte ich mir vor, daß man eine Vergewaltigte ein wenig anders anfassen würde oder etwas weniger oder überhaupt nicht. Schließlich sagte ich das Franny und sie starrte mich an. „Du irrst dich“, sagte sie, aber es klang, wie wenn sie zu Frank sagte: „Du bist ein Arschloch“ und dazu hatte ich das Gefühl, daß ich wahrscheinlich ewig vierzehn bleiben würde. Dieses kleine Zitat aus dem Roman macht das Dilemma deutlich; in bezug auf Vergewaltigte und andere Traumatisierte bleiben wir alle irgendwie vierzehnjährig – man kann es auf eine bestimmte Weise nicht verstehen, auf eine andere natürlich durchaus. Wir, darauf weist uns Frannys Antwort hin, irren uns immer. Doch kann man sehen, wie die literarische Feinfühligkeit alles, was zum Trauma gehört, hier zusammenträgt: die Art der „ersten Hilfe“ ist außerordentlich wichtig, Nahestehende sind schwer affiziert und doch so ratlos, es gibt das Problem der Stigmatisierung: ist eine Vergewaltigte wie eine Invalidin anzufassen, wie eine Behinderte? Bescheid wissen über’s Trauma? 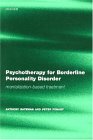 Wohltuend, wenn diese Ratlosigkeit nicht überspielt wird. Das neue Buch von Anthony Bateman und Peter Fonagy „Psychotherapy for Borderline Personality Disorder – mentalization based treatment“ (Karnac Books 2004) behandelt diese Fragen mit Kenntnis und Erfahrung, und deshalb mit großer Vorsicht. Wohltuend, wenn diese Ratlosigkeit nicht überspielt wird. Das neue Buch von Anthony Bateman und Peter Fonagy „Psychotherapy for Borderline Personality Disorder – mentalization based treatment“ (Karnac Books 2004) behandelt diese Fragen mit Kenntnis und Erfahrung, und deshalb mit großer Vorsicht.„Therapists sometimes also make inapropriate ‚expert’ statements about the kind of mental representations that they expect to see in patients with a history of abuse. Yet most therapists’ experience in this area is quite limited.” (S. 108) Und schon vorher hatten die Autoren die Gründe für diese Zurückhaltung genannt: „The clinical risk of overemphasizing trauma from our point of view will be made clear ... We will argue that borderline individuals may have a specific vulnerability in understanding their own states of mind. Consequently, they are particularly eager to identify a coherent account of the pain they experience and they are in a poor position to critically appraise persuasive suggestions put to them. A psychotherapist who is overconfident concerning the aetiological significance of a vaguely remembered or even unremembered account of maltreatment places his or her client at risk in a number of ways: (1) by paying insufficient attention to other aetiologically possibly more significant psychosocial experiences; (2) by suggesting to the client that their abuse experience was graver than it was, distorting the client’s experience of reality and potentially undermining the client’s relationship with the individuals concerned; (3) given the substantial nature of the claim, generating a dependence on the person of the therapist through whose superior ‘superior knowledge’ the client’s discomfort may be diminisheed, even at the expense of generating new instances of maltreatment experience; and (4) because the clinician is dictating the topic, the client is forced to adopt a passive position in relation to their own experience and an agentive sense of self will be hard to recover.” (S. 27) Einen “agentive sense of self” wieder zu ermöglichen, darf man wohl als das Ziel des “mentalization based treatment” (MBT) ansehen – aber was ist ein solcher „agentive sense of self“? Dazu wird die Theorie der Mentalisierung in diesem Buch zusammenfassend vorgestellt, dessen Hauptziel eine Art Manual ist, wie Borderline-Patienten mit diesem Verfahren behandelt werden sollen. Ich stelle nun die Theorie der Mentalisierung vor und dann einige der Leitlinien von Bateman und Fonagy. Für systemische Therapeuten besonders interessant dürfte sein zu beobachten, daß die Entwicklung innerhalb der Psychoanalyse deutlich auf einen „relational approach“ zuläuft – es geht nicht um immer „tiefere“ Einsichten ins Intrapsychische, sondern um förderliche und hilfreiche Beziehungsgestaltung, die die Besonderheiten von Patienten kunstvoll berücksichtigt. Will man über diese Theorie im Detail Bescheid wissen – und das lohnt sich schon! – bleibt einem die Lektüre des entsprechenden Buches von Fonagy/Gergely/Jurist/Target: „Affektregulierung, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst“, das gerade auf Deutsch bei Klett-Cotta (2004) erschienen ist, nicht erspart – aber es gibt Hoffnung. Dankenswerterweise nämlich hat Martin Dornes, der Unermüdliche und Kenntnisreiche in Sachen Darbietung internationaler Befunde aus dem Reiche der baby-watcher, dieses Buch bereits in seiner englischen Originalfassung gelesen. So liegt von ihm schon rechtzeitig eine ausführlich informierende Zusammenfassung im Heft (2/04) des „Forum der Psychoanalyse“ vor. Man muß vor diesem neuen Konzept keine Angst haben; nach der Darstellung einiger Befunde zur Epidemiologie der Borderline-Störung schreiben Bateman und Fonagy richtig: "Mentalization as a concept has arguably been part of psychoanalytic thinking since its inception". (Bateman und Fonagy 2004, S. 71). Und kurz vorher heißt es prägnant in dem Buch: "For normal development the child needs to experience a mind hat has his mind in mind..." (Bateman und Fonagy 2004, S. 68). Im Deutschen könnte man schön doppeldeutig sagen: Ein Kind muß “bedacht” werden, wenn es keinen „Dachschaden” davon tragen soll. Es muß jemand geben, der es „bedenkt“, dem seine Entwicklung und sein Wohlergehen, seine Person und seine Erfahrung am Herzen liegt – ob man „mind“ mit Herz oder Kopf wiedergibt, ist hier ziemlich gleichgültig. Geburtshelfer: „theory of mind“ und Bindungsforschung Auch Dornes hält das Mentalisierungskonzept für eine „Fortführung psychoanalytischer Debatten über Symbolisierung“ (S. 175). Der eine Geburtshelfer bei diesem Konzept ist die „theory of mind“-Forschung, die die Frage sondiert, ab wann kleine Kinder entdecken, daß sie selbst Wesen mit mentalen Zuständen sind. Der andere ist die Bindungsforschung, über die schon so viel gesagt wurde, daß ich sie hier außen vor lasse. Mentalisierung meint nun folgendes: Kinder sehen zwar Verhalten, aber sie verstehen Absichten, Pläne, Vorhaben. Mentale Zustände werden erschlossen, zunächst am Anderen, mehr und mehr dann auch bei sich selbst. Das beginnt etwa im Alter von anderthalb Jahren. „Unter Mentalisierung wird indes nicht nur die Fähigkeit verstanden, hinter Verhalten seelische Zustände zu vermuten, sondern auch die weiter gehende Fähigkeit, die vermuteten mentalen Zustände selbst wieder zum Gegenstand des (Nach-)Denkens zu machen. Diese Fähigkeit zum Denken über das Denken wird Metakognition genannt und entsteht mit etwa 4 Jahren. Dann verfügt das Kind nicht nur über ein mentales, sondern auch über ein repräsentationales Weltbild, in dem es den subjektiven Charakter seiner geistigen Hervorbringungen durchschaut“. (Dornes 2004, S. 176). Was durch Fonagy und seine Mitautoren nun diesem Konzept neu hinzugefügt wird, ist die Auffassung, daß es sich hierbei keineswegs nur um Reifungsprozesse handelt, sondern solche Mentalisierung abhängig ist von der Affektregulierung des Kindes durch Eltern oder andere Erwachsene, also von der interaktiven Qualität der familiären Beziehungen. Markierung und referentielle Entkopplung Erwachsene können die Affekte eines Säuglings auf mehrere Arten spiegeln:
Von der Markierung der Affekte geht dann eine Linie zur Entwicklung der Fähigkeit, mit der Realität zu spielen, die sich ebenfalls in der Zeit zwischen anderthalb und vier Jahren entwickelt. Dabei können zwei Modalitäten, wie die eigenen Gedanken und Gefühle erfahren werden, unterschieden werden:
Sie sagt uns aber noch mehr, nämlich über die Rolle der Affektregulation von solchen Beziehungen, von Spiel und symbolischem Denken. Als Säuglinge können Kinder nicht viel zur eigenen Affektregulierung beitragen, außer vielleicht den Blick abwenden oder sich mit dem Daumen trösten. Sie sind leicht von Affekten ansteckbar. Aber der markierte Umgang mit dem kindlichen Affekt ist humanspezifisch; er hilft dem Kind, Kontrolle über den Affekt zu gewinnen. Beim Spiel kommt noch die Möglichkeit der Modifizierung des Geschehens hinzu. Aus diesen drei Komponenten – Als-Ob-Modus, Situationskontrolle durch Markierung und Modifizierung im Spiel – baut sich nun die weitere symbolische Tätigkeit auf, die als Tagtraum und Ausbildung von Phantasie ihre affektregulierende Funktion übernimmt. Situationen können simuliert, es kann auf Probe gehandelt, Geschehenes erinnert werden. Spiel, Affekt und Selbst Affektspiegelung, Spiel und Phantasieren regulieren aber nicht nur den Affekt, sondern zeigen dem Kind auch ein bestimmtes Bild von sich selbst. Es sieht im Gesicht der Mutter, die einen eigenen Affekt markiert darstellt, eine „externe Darstellung seiner eigenen Zustände“ (Dornes) und es wird sich derer allmählich bewußt; sie bilden den Kern der entstehenden Selbstrepräsentanz. Das gilt aber nicht nur für Affekte, sondern auch für Handlungen. Das Kind agiert als ein Körper im Raum, es ist ein „physical agent“, der sich allmählich auch als sozial Beteiligter („social agent“) versteht, der – ab etwa dem 9. Lebensmonat – zielgerichtet auf die Dinge und Menschen zugeht („teleological agent“). Mit etwa anderthalb Jahren wächst dies zum „self as mental agent“ heran, der von mentalen Zuständen jenseits des Verhaltens weiß und sich allmählich zu einem „self as representational agent“ entwickelt. Jetzt wird verständlich, was mit einem „sense of agentive self“ gemeint ist: In solchen Interaktionen entwickelt sich ein Sinn für die eigenen wie die fremden Absichten, für das „Gemeinte“ jenseits des Gezeigten, für die Koordinationsbedürftigkeit und für feine Abstimmungsnotwendigkeiten, für die Notwendigkeit, sich als Teil eines komplexen Beziehungsgefüges zu sehen. Borderline-Patienten können auf diesem Weg in vielerlei Hinsicht blockiert oder verstört worden sein. Dornes hat ein instruktives Beispiel parat. Man sieht auf voller Straße einen Bekannten entgegenkommen, der auf die andere Straßenseite wechselt. Ich kann nun annehmen, daß er das tut, um mir nicht zu begegnen. Ein solcher Schluß operiert mit Überzeugungen höherer Ordnung: Ich glaube, daß er glaubt... Ich kann aber auch glauben, daß er das tut, um auf der anderen Seite seinerseits schneller voran zu kommen und mache dann von einer teleologischen Schlussfolgerungen Gebrauch und muß mich nicht beunruhigen. Auf diesen Modus reagieren Borderline-Patienten verstärkt, denn das Verhalten wird dann als nicht mehr bedeutungsvoll aufgefasst, sondern nur noch als funktionell. Aber typisch für den Borderline-Patienten wäre dann die unkorrekte Mentalisierung, wenn ich etwa am nächsten Tag der Überzeugung bin, daß alle mich meiden. Wenn ich dann noch jemandem begegne, der in sich gekehrt mich nur kurz grüßt, werde ich entweder meine Hypothese, daß alle mich meiden aufgrund meiner Unerträglichkeit bestätigt sehen und mich depressiv zurückziehen oder paranoid Vorwürfe machen und etwas zu „klären“ suchen, wo es nichts zu klären gibt – der andere war einfach in sich gekehrt. Borderline-Patienten also tun sich schwer, „eigene und fremde mentale Zustände (korrekt) zu identifizieren“. So fasst Dornes (S. 189) zusammen. Und dieser Autor, der auch offene Fragen dieser Theorie beschreibt, meint, viele Leser werden bei der Lektüre der von Fonagy/Gergely/Jurist/Target beschriebenen Kasuistiken meinen, sie hätten das schon immer gewusst. Und er fügt an: „Wahrscheinlich stimmt das sogar“ (S. 190). Dennoch – es ist klar, daß diese Theorie gewissermaßen den Unterbau zum psychoanalytischen Symbolisierungskonzept liefert und diesen Unterbau in den Interaktionsgeschichten verankert. Bei Borderline-Patienten findet sich häufiger eine Geschichte von Missbrauchserfahrungen – nicht unbedingt nur der groben, sexuellen Art, sondern auch von der Art wie in der Geschichte von der brennenden Zigarette in Mutters Hand. Geschichten von gewollter Ignoranz des Kindes, Abweisung oder latenter Gewaltdrohung. Kinder mit solchen Erfahrungen sind davon nicht „programmiert“, sie haben ihrerseits verschiedene Arten zu reagieren, was nicht unerheblich zu den Schwierigkeiten der Borderline-Diagnose beiträgt. Ein bedrohtes Kind kann etwa aufhören, sich mit den mentalen Zuständen seiner Eltern zu beschäftigen, weil es nichts Gutes entdecken könnte und hält dadurch wenigstens die Illusion von Bildungssicherheit aufrecht. Es kann aber auch besonders aufmerksam werden und die mentalen Zustände sorgfältig „scannen“, wie man das von manchen dissozialen Patienten kennt; manchmal berichten sie einem dann solche Dinge, daß sie am Hervortreten des Kinnmuskels zu erkennen lernten, ob der Vater angespannt wurde und Strafen zu erwarten waren. Dies „scanning“ sensibilisiert für Andere, nicht aber für eigene mentale Zustände, weshalb mit solchen Menschen so schwer introspektive Psychotherapie zu machen sein dürfte. Andere können nur schwer zwischen Spiel und Ernst unterscheiden und reagieren auf humorvoll gemeinte „Frozzeleien“ aggressiv oder auf spöttische Infragestellungen schnell mit Scham und Verlegenheit, was dann wiederum aggressiv abgewehrt wird. Wiederum andere nutzen die eigenen mentalen Zustände, um sich die von anderen zu erklären; das ist manchmal triftig, manchmal aber auch vollständig daneben. In jedem Fall begrenzt es die Möglichkeiten, sich das Verhalten Anderer zu deuten und kann für den Betreffenden nicht von einer Projektion unterschieden werden. Schließlich auch haben manche Menschen in neutral-distanzierten Beziehungen wenige Mentalisierungsprobleme, aber geraten in heftige Turbulenzen bei intimeren oder auch nur näheren Beziehungen. Hier gibt es noch erheblichen Klärungsbedarf, aber man erkennt die beträchtliche Reichweite dieser Theorie. Es handelt sich um nicht weniger als um eine „Theorie der interaktiven Entwicklung des menschlichen Geistes auf Augenhöhe mit dem Wissen anderer Disziplinen“, wie Dornes abschließend würdigt. Immerhin wird so vorstellbar, daß hier ein Borderline-Konzept vorgestellt wird, daß sich von Kernbergs BPO erheblich unterscheidet; die zentrale therapeutische Bemühung muß auf die (Wieder-)Herstellung der Mentalisierungsfähigkeit ausgerichtet sein. Frühe Störung und Mentalisierung Auch der Beitrag von Lotte Köhler, im gleichen Heft des „Forum der Psychoanalyse“ widmet sich den frühen Störungen aus Sicht der Mentalisierungstheorie. Diese Autorin hat verdienstvollerweise früher auch schon die Bindungstheorie vorgestellt und auf ihren therapeutischen Nutzen hin befragt; die gleiche Absicht verfolgt auch dieser neue Aufsatz. Sie macht sich die folgende Definition zu eigen: "Mentalisierung ist unsere Fähigkeit das Verhalten anderer Menschen vorauszusehen und zu erklären und zwar in Begriffen ihrer mentalen Befindlichkeiten, also dessen, was sie annehmen, wünschen, hoffen, beabsichtigen, vortäuschen oder vorgeben... Die Fähigkeit der Mentalisierung ist weitgehend unbewusst oder implizit. Sie ist eine kognitive Leistung, die dem eigenen Verhalten und dem anderer automatisch einen Sinn gibt". (Köhler 2004, S. 158) Sie spricht von einer „Entwicklungslinie der Mentalisierung“, die pränatal beginnt, dann aber mächtig unter den Einfluß der Umwelt gerät. „Damit sich die Fähigkeit der Mentalisierung entwickeln kann, muss das Kind sie zunächst bei seiner Mutter an sich selbst erfahren haben“ (Köhler S. 161). Die Entwicklungslinie kann man ungefähr datieren:
Behandlungspraxis Nun, dies alles hat Folgen für die Behandlung von Borderline-Persönlichkeitsstörungen (BPD). Die von Bateman und Fonagy entwickelte „mentalization based therapy“ (MBT) hat zum Ziel, traumatische Erfahrung, die teilweise für die BPD mitverantwortlich ist, durchzuarbeiten. „While reconstruction of how things were in childhood may significantly contribute to therapeutic action, this does not however mean that the outcome of reconstruction, the remembering of a hypothetical autobiogrphical event, has anything whatever to do with ‘cure’. It is the process of re-working current experience in the context of the other, in this case childhood, perspectives, that we believe to be curative. The crucial component is the provision of a perspective of a frame for interpreting subjectivity that is beyond that which the patient has ready conscious access to apart from the analytic encounter. But the ‘other perspective’ need not be that of the patient’s childhood, it could be the analyst’s current experience, or the way the patient is experienced by others close to him…” (Bateman und Fonagy 2004, S. 107) In dieser Berücksichtigung der Perspektive des Anderen wird also das zentrale therapeutische Agens erblickt, das zur Überwindung des Äquivalenzmodus führen kann; entscheidend wird, daß der Patient entdeckt, daß man die Dinge durch wenigstens zwei Perspektiven sehen kann. In Deutschland ist v.a. die „transference focused therapy“ von Kernberg für die Behandlung von BPD bekannt, das Bateman und Fonagy ausgiebig darstellen und in manchen Hinsichten als „drakonisch“ beurteilen (S. 116), etwa wenn dem Patient bei Suizidversuchen mit dem Behandlungsabbruch gedroht wird. Die dialektische Verhaltenstherapie von Linehan wird mit Sympathie betrachtet; nun, Linehan schrieb 1993, die von ihr entwickelte Therapie sei „more similar to the psychodynamic emphasis on transference behaviours than it is to any aspect of standard cognitive behavioural therapies“. Auch diese Autorin anerkennt den Wert der therapeutischen Beziehung und deren Analyse für die Entwicklung von Affektregulation und „mindfulness“. MBT nun wird auf 18 Monate stationärer Behandlung angesetzt, mit zwei bis 5 wöchentlichen Therapiesitzungen, die von Gruppentherapie und expressiven Therapieverfahren begleitet werden. Zentral therapeutisch angegangen wird die Selbst-Struktur, um dem Patienten sicherere Beziehungen zu ermöglichen; der psychische Äquivalenz- und der Als-Ob-Modus, um beide zu einer besseren Integration („zwei Perspektiven“) zu bringen und insgesamt die Entwicklung der Mentalisierung zu fördern. Aufgabe des Therapeuten ist dabei (S. 203), kontinuierlich den „internal mental state“ sowohl seines Patienten als auch sich bei sich selbst zu beobachten, weil nur so verstanden werden könne, was gerade passiert. Dies gilt insbesondere für die außerordentlich massiven emotionalen Reaktionen, denen auch Therapeuten ausgesetzt sind. Den inneren mentalen Zustand zu beobachten, ihn in Verbindung mit der Übertragungsbeziehung deutend zu verstehen, dabei Affekte und Bedeutungsgebungen zu klären und das im Rahmen einer sicheren Bindungsbeziehung ist das zentrale therapeutische Programm. Etwas von dem Geist, in dem Bateman und Fonagy schreiben, teilt sich mit, wenn sie betonen, hier komme es nicht auf eine Technik, nicht auf Änderungstechnologie an: „The borderline patient needs a flexible, thinking but consistent therapist, whether it is to assist them with learning mindfulness skills or with developing mentalization, and those characteristics are not the exclusive property of any one therapy but more a function of the therapist himself“. (S. 126) Dieser Gesichtspunkt, daß die höhere Mentalisierungsfähigkeit des Therapeuten ausschlaggebende Rolle spielt, wird immer wieder betont. Mentalisierung ist, wegen ihres Ursprungs in der interaktiven Bezogenheit, etwas anderes als Introspektion; Mentalisierung zielt auf „mind-reading“, ist ein Konzept jener Fähigkeit, die Absichten des Anderen „lesen“, verstehen, aufgreifen, darauf reagieren zu können. Weil BPD zeigt, daß hier eine Störung interaktiven Ursprungs vorliegt, braucht der Borderline-Patient „the experience of other human minds having the patient’s mind in mind“. Das ist die erste und allgemeine Charakteristik jeder Therapie. Dies alles muß, zweitens, im Kontext einer affektregulierenden sicheren Bindungsbeziehung etabliert werden, denn sichere Bindung und Mentalisierung haben einen synergetischen Effekt: wer sich sicher fühlt, kann auch besser in Ruhe nachdenken. Dazu muß der Therapeut, drittens, in seinen Gedanken beständig die gedankliche Welt seines Patienten vor Augen haben; Gefühle werden sorgfältig benannt, Gedanken geklärt. Viele Borderline-Patienten können nur schwer zwischen Sein und Sollen unterscheiden oder übernehmen wie selbstverständlich die Perspektive Anderer, um die eigene zu ersticken. Die Neutralität, in der Therapeuten trainiert werden, bekommt hier eine interaktive Bedeutung; sie zeigen ihrem Patienten im markierten Modus, daß sie dem Patienten seine, nicht ihre Emotionen spiegeln. Mentalisierung wird dann, viertens, eine Erfahrung der gemeinsam geteilten Aufmerksamkeitsfokussierung, die aufrechtzuerhalten eine neue therapeutische Aufgabe wird, etwa wenn Patienten ihre emotionalen Erlebnisse vertiefend explorieren und sich gerne dann dabei ablenken. Entscheidend ist dabei nicht so sehr der Inhalt der Aufmerksamkeitsfokussierung, sondern der Prozess des Gemeinsamen. Der Therapeut ist deshalb, fünftens, in seinen Reaktion beständig auf Mentales ausgerichtet, weil er sich mit den Übertragungsreaktionen, automatischen negativen Gedanken, reziproken Rollenzuschreibungen oder äquivalentem Denken befasst. Er formuliert damit, sechstens, gewissermaßen die Welt seines Patienten so, daß er ihm dabei hilft, die implizite „Information“ seines Geistes allmählich in eine explizite „Information“ zu verwandeln. Diese Maximen leiten das gesamte Behandlungsteam, weshalb die Lektüre dieses Buches auch Teams und nicht nur Einzelpersonen empfohlen wird – ein sehr einleuchtender Schritt! Die Team-Mitglieder sollten – immerhin haben sie es mit Gewalttätern und teilweise in Haft befindlichen Menschen zu tun – ein großes Maß an „Resilienz“, Widerstandskraft, aufbringen. Sie müssen ihre persönlichen Grenzen aufrechterhalten und zugleich ein hohes Maß an Flexibilität zeigen, kompetent mit Provokationen umgehen, Angst ertragen und Druck zur Grenzüberschreitung in vielerlei Hinsicht regulieren können. Die Aufnahmeprozedur umfasst Klärungen darüber, wie der Patient seine Probleme sieht; ihm wird die zugrundeliegende Behandlungskonzeption angemessen erläutert und er wird über Einzel- und Gruppentherapie informiert. Patienten werden zu Verschwiegenheit (Gruppe) verpflichtet und ihnen dieselbe umgekehrt zugesichert. Und es wird ihnen erklärt, daß Gewalt unter keinen Umständen toleriert wird, weder verbal noch physisch. Das Buch enthält einige wertvolle Hinweise auf jene Borderline-Patienten, die zugleich ihre anti- oder dissozialen oder paranoiden Tendenzen agieren müssen (S. 235 f.). Sexuelle Beziehung „are strongly discouraged“. Hauptaufgabe ist zu Anfang, den Patienten in die Behandlung zu engagieren. Dazu gehören Klärungen der Rollen des Personals, von Notfallprozeduren und Definition der Verantwortlichkeiten des Patienten. Seine Geschichte wird sorgfältig aufgenommen, insbesondere bezüglich früherer Suizidversuche, intimer Beziehungen, früherer Behandlungen, Gewaltepisoden, emotionale Erregungszustände. Der Aufbau der Arbeitsbeziehung wird hier schon eingeleitet und durch Empathie gestützt; dem äußeren Rahmen – die Sitzungen finden pünktlich zu den vereinbarten Zeiten statt – wird große Bedeutung gegeben. Zuhören ist oberste Tugend, um zu einer „dynamic formulation“ zu gelangen. „The purpose of developing a dynamic understanding of the patient’s problems is to place feelings and behaviour within an individual context and to commence the development of a coherent interpersonal and developmental narrative. Frequently, borderline patients have an incoherent narrative that makes little sense to them, leaving them unable to explain their personality develoments with any lucidity. They become schematic and categorical, linking specific events with explicit problems. The development of the formulation is the beginning of helping the patient to understand himself by exploring his personal story.” (S. 169 f.) Auf diese Weise wird eine drop-out-Rate von nur 12% erreicht (S. 126). Patienten, die abbrechen, können sich selbst wieder anmelden, ihre Entscheidung wird ausdrücklich als reversibel dargestellt, so daß die Schamschwelle bei einem eventuellen Wiedereintritt ins Programm bewußt niedrig gehalten wird. Viel wird für die „Team-Moral“ getan, Supervision selbst der „alten Hasen“ ist selbstverständlich: „It is impossible to maintain team morale and to deliver effective treatment without supervision“ (S. 177). SV hat zu Ziel, dem Therapeuten dabei zu helfen, bei der Methode zu bleiben, dazu ist eine „therapist adherence scale“ (S. 315) entwickelt. Der Therapeut soll frei über seine Schwierigkeiten sprechen können und schließlich heißt es: „supervision is part of in-service training and the validation of the therapist’s skills“ (S. 178). Die eigentlich therapeutischen Kunstfertigkeiten bei der Implementierung sind nun natürlich auf Mentalisierung bezogen. Borderline-Patienten brauchen Struktur. Ich zitiere einmal, wie die Autoren „Struktur“ beschreiben, weil das den angenehmen Stil, die Atmosphäre gut wiedergibt: „Structure is needed to form a framework around therapy that is neither intrusive nor inattentive and which, much like a benevolent uncle, can remain in the background but be around to catch things when they get out of control“ (i.O. kursiv, S. 183 f.) Diese Metapher vom wohlwollenden Onkel hat angesichts von Verführungen und familiären Verwirrungen, eine eigene Färbung; aber hier ist natürlich ein Hintergrund des wohlwollenden Haltens gemeint, der a-personal ist und insofern wohl hilfreich. Das nächste Behandlungsprinzip heißt deshalb dann auch „consistency, constancy and coherence“. Veränderungen kommen aus der Fokussierung auf die Beziehung. So entsteht ein sichernder, strukturierter Rahmen und zugleich wird Wandel an die Untersuchung und Entwicklung der personalen Beziehung zum Therapeuten gebunden. Der charakteristischerweise instabile Lebensstil von Borderline-Patienten braucht eine flexible Behandlungsführung, denn die Instabilität manifestiert sich natürlich in Bezug auf psychiatrische Dienste und andere helfende Einrichtungen. Jede dieser Maximen wird begründet: „Without flexiblity, the borderline patient cannot be engaged in treatment. Their tenuous grasp of personal identity is weakened by any interpersonal encounter. This includes discussing their problems in detail with mental health professionals. Once their representation of themselves in relation to another becomes confused, their response can only be either to leave the apparently threating situatio or to resort to rigid representations of themselves in relation to others. Both solutions stabilize their sense of self but at the same time undermine motivation for treatment. Treatment becomes dangerous and something to be avoided whilst at the same time being the very thing that they wish for. It is necessary for the therapist to ensure that the patient’s sense of self remains stable during the early stages of treatment. Only later is the therapeutic relationship likely to withstand the panic associated with destabilization” (S. 191) Das Prinzip der Intensität sucht genau auf diese Schwierigkeit einzustellen: solche Patienten brauchen „intensive care“, aber nicht so viel, daß ihre Panik zu sehr anwächst – dann wird die Bindungsbeziehung gefährdet, sie können nicht mentalisieren und damit desintegriert ihre Affektregulation. Auf diese Weise wird verständlich, wie genau diese Behandlungsprinzipien von der Mentalisierungstheorie abgeleitet sind. All dies folgt einem individuellen Ansatz, der Patient wird nicht dazu angehalten, sich einem rigiden Programm zu unterwerfen. Medikamentenvergabe geschieht sparsam unter Berücksichtigung des „mental state“ und der Übertragungs-Gegenübertragungsdynamik. Von dieser „Implementierung“ werden nun eigentliche „strategies of treatment“ unterschieden. Der Therapeut muß einen „mentalizing stance“ einnehmen, d.h. sein Handeln wird geleitet von der Beachtung der „mental states“ seines Patienten und bei sich selbst. Die nächste Aufgabe heißt „bridging the gap“, nämlich die Lücke zwischen der primären affektiven Erfahrung des Borderline-Patienten und deren symbolischer Repräsentation schließen. Die Übertragung wird nicht als „Irrtum“ oder als „Realitätsverzerrung“ aufgefaßt. „Transference is experienced as real, accurate, and current by the borderline patient and needs to be accepted by the treatment team in that way” (S. 207). Wenn also ein Patient meint, der Therapeut habe heute schlechte Laune, wird danach gefragt, was ihn dazu gebracht habe, was er auf dem Gesicht oder an der Haltung seines Therapeuten wahrgenommen habe und ggf. wird ihm mitgeteilt, daß das nicht stimme und das Angebot gemacht, darüber nachzudenken, was den Patienten zu dieser Vermutung gebracht haben könnte. Der Therapeut hat die Aufgabe, im Sinne der „Markierung“ den Gefühlszustand des Patienten wiederzugeben („Retaining mental closeness“), was ausdrücklich in Analogie zur Säuglingssituation beschrieben wird. Der Fokus liegt dabei ausdrücklich auf den aktuellen „mental states“. Themen der Vergangenheit werden zur Klärung aktueller mentaler Zustände besprochen. Einem zu umfänglichen Metapherngebrauch wird in Anfangsphasen eher abgeraten, weil solche Patienten gerne diese Hilfsmittel nutzen, um in die Bilderwelt abzutauchen und ihre realen Schwierigkeiten zu verbergen (S. 213). Grundsätzlich sollte der Therapeut wissen, daß Borderline höchst intensive und persönliche Beziehungen gestalten, auf die der Therapeut entweder mit Rückzug reagiert oder indem er die Differenz zwischen therapeutischer und persönlicher Beziehung verschwinden läßt. Eigentliche Behandlungstechniken im engeren Sinn sind
Das Buch enthält eine Fülle von Beschreibungen therapeutischer Sondersituationen, etwa wenn ein Patient in der Gruppe passiv-aggressiv provoziert oder sich verführerisch verhält und die anderen zu erregen versucht. Ziemlich handfest wird, auch an ausführlichen Fallbeschreibungen, geraten, was zu tun sei. Ein abschließendes Kapitel enthält Ratschläge für diejenigen, die eine solche Therapiekonzeption bei sich implementieren wollen. Die Entdeckung der Gegenseitigkeit Es kann nicht anders sein, als das ein solches Buch zu vielerlei Thematisierungen Anlaß geben wird. Ich möchte hier zwei, eine methodische und eine philosophisch inspirierte Anmerkungen machen. Die methodische Anmerkung bezieht sich auf das Wort „Manual“. Was die Autoren hier vorlegen, ist im Grunde nicht dasselbe wie ein Manual in der empirischen Forschung, wo man monosymptomatische Störungsklassen („generalized anxiety disorder“) beschreibt und dann „Interventionsabfolgen“ zu deren Beseitigung. Je genauer ein solches, empirischen Standards folgendes Manual wäre, desto problematischer würde seine Anwendbarkeit in der professionellen Praxis. Man kann dann genauestens untersuchen, wie interveniert wurde, mit hoher interner Validität, aber die beißt sich dann mit der externen Validität. Die Autoren sind sich dieses Problems genau bewußt, flechten viele „antidogmatische“ Stellungnahmen ein, plädieren immer wieder für Flexibilität (was für empirische standards tödlich wäre) und haben eigentlich eine komplexe Theorie beschrieben, die mit zahllosen Anwendungsbeispielen anschaulich illustriert wird und von Personen und Teams erst einmal angeeignet werden muß. Das ist gute Tradition, aber eigentlich nennt man sowas in der Tradition „Lehrbuch“. Die Profession hat sich immer schon mit Falldarstellungen verständigt, dabei freilich in den letzten Jahren derartig theorielastige Falldarstellungen verfaßt, daß vielfach nicht zu erkennen war, welche Chance die Fälle hatten, der Theorie zu widersprechen. Wenn also die Tradition hier unter anderem Namen fortgeführt wird, kann ich das ebenso begrüßen wie wenn es dazu führte, daß die Profession sich ermahnt fühlt, ihre Fälle über die Theorie hinaus deutlicher hervortreten zu lassen. Nur dann nämlich ist etwas zu lernen – und auch das zeigt das hier besprochene Buch. Es könnte nun – meine zweite Anmerkung - sein, daß das Konzept der Mentalisierung, die Einbeziehung des Anderen, die Beachtung von dessen Art und Weise, der ermöglichten oder verhinderten Bezogenheit an etwas erinnert, das einerseits zu den traditionellsten Ideen gehört, andererseits in der Einpersonenpsychologie aber schwer ignoriert worden ist: dass Menschen soziale Wesen sind. Hier ist, hoffentlich längst erkennbar geworden, der Bezug zu dem, was in der Systemischen Therapieorientierung vertreten wird. In den Sozialwissenschaften hatte man spätestens seit Erving Goffman und Harold Garfinkel, aber auch früher schon, also seit den 1930er Jahren!, bei Alfred Schütz und Talcott Parsons von der Unhintergehbarkeit der Reziprozität gesprochen. Reziprozitätsnormen, so hieß das umständliche Wort, sind die, deren Verletzung schwere Folgen hat, weil man nicht nur dem Anderen etwas zufügt, sondern indem man diese Regel verletzt, verletzt man letztlich auch sich selbst. Wer einen anderen beschädigt, ohne auf seinen Zustand zu reflektieren, also ohne Schuldgefühle, beschädigt sich selbst, weil er im Grunde so handelt, als könne die Verletzung der Norm auch auf ihn angewendet werden, als dulde er, selbst verletzt und beschädigt zu werden. Kurz, wenn Mentalisierung also die Wiederkehr einer Gestalt der Philosophie („Denken des Denkens“) ist, dann ist das auch die Wiederkehr des kategorischen Imperativs, wonach man stets so handeln solle, daß daraus eine allgemeine Norm werden könne; oder verballhornt: Was du nicht willst, das man dir tu, das füg’ auch keinem andern zu. Darin also kommt der Andere als Selbstaspekt immer schon vor, aber das Selbst, das hier gemeint ist, ist dabei umfänglicher gedacht als nur ein individuelles Selbst. Wie liesse sich ein Begriff des Selbst mit dem „System“ (der Interaktionen und Beziehungsregulierungen auf kognitivem und affektivem, ja sogar auf neuronalem Niveau) vereinbaren? Kontakt mit dem Autor über email: buchholz.mbb@t-online.de Peter Fonagy's website Eine ausführliche Darstellung des erstgenannten Buches von Kurt Eberhard für AGSP Verlagsinfo: Dieses Buch ist eine groß angelegte Synthese, in der es um das spannungsreiche Gegen- und Miteinander der Psychoanalyse und der Bindungstheorie geht. Es gelingt, eine Brücke zwischen den beiden Disziplinen zu schlagen, indem die Autoren das Bindungskonzept neu beleuchten. Es geht nicht mehr nur um die Herstellung von Bindung an sich, sondern darum, das Kind durch sichere Beziehungen der Art auszustatten, daß es das Verstehen mentaler Zustände im Anderen und im Selbst entwickelt. Das Konzept der Mentalisierung wird so zum zentralen Punkt für das menschliche Funktionieren im sozialen Umfeld. » » » Unter Mentalisierung wird die Fähigkeit verstanden, auf das Verhalten eines anderen Menschen - angemessen - zu reagieren. Vereinfacht ausgedrückt befähigt Mentalisierung also, anderer Leute Gedanken und Gefühle zu »lesen«. Diese Fähigkeit entwickelt sich beim Säugling dann, wenn die Mutter seine Affektäußerungen aufnimmt und sie ihm durch ihre Mimik »widerspiegelt«. Durch diese Spiegelung erkennt das Kind seine eigenen Affekte. Menschen mit schweren Psychopathologien - das hat die Arbeitsgruppe um Fonagy festgestellt - fehlt diese Fähigkeit. Die Entwicklung einer stabilen Persönlichkeit hängt also von einer funktionierenden Beziehung mit der Mutter ab. Inhalt: Einleitung Erster Teil Theoretische Perspektiven 1. Kapitel Bindung und Reflexionsfunktion: ihre Bedeutung für die Organisation des Selbst 2. Kapitel Affekte und Affektregulierung in historischer und interdisziplinärer Sicht 3. Kapitel Das psychosoziale Entwicklungsmodell der Mentalisierung und die Verhaltensgenetik Zweiter Teil Entwicklungspsychologische Perspektiven 4. Kapitel Die Theorie des sozialen Biofeedbacks durch mütterliche Affektspiegelung 5. Kapitel Die Entwicklung eines Verständnisses des Selbst und seiner Urheberschaft 6. Kapitel "Mit der Realität spielen": Entwicklungsforschung und ein psychoanalytisches Modell der Subjektivitätsentwicklung 7. Kapitel Markierte Affektspiegelung und die Entwicklung eines affektregulierenden Gebrauchs des Als-ob-Spiels 8. Kapitel Entwicklungsaufgaben der normalen Adoleszenz und adoleszenter Zusammenbruch Dritter Teil Klinische Perspektiven 9. Kapitel Die desorganisierte Bindung als Entwicklungsgrundlage der Borderline-Persönlichkeitsstörung 10. Kapitel Psychische Realität in Borderline-Zuständen 11. Kapitel Mentalisierte Affektivität im klinischen Setting |
||||
|
|||||
|
Besuche seit dem 27.1.2005:   |

