 |
| Druckversion |
|
|
| Interview mit Rosmarie Welter-Enderlin |
||||
|
||||
Heute, am 24.2.2007, wird Rosmarie Welter-Enderlin 72 Jahre alt. Sie hat die deutschsprachige familientherapeutische und systemische Szene mit zahlreichen Vorträgen, Workshops und Veröffentlichungen nachhaltig geprägt, vor allem aber mit ihren wegweisenden Kongressen, die sie mit ihrem Meilener Team in regelmäßigen Abständen in Zürich organisierte, mit denen sie nicht nur bedeutsame Akzente im systemischen Diskurs setzte, sondern auch dafür sorgte, dass bestimmte Themen überhaupt (wieder) Eingang in diesen Diskurs fanden. Mittlerweile hat sich Rosmarie Welter-Enderlin – wie lange geplant – aus dem Institutsbetrieb des von ihr gegründeten Ausbildungsinstituts in Meilen zurückgezogen. Zum Geburtstag bringt systemagazin ein Interview mit ihr über ihre eigene Lerngeschichte, das kurze Zeit vor ihrem Rückzug aus dem Institut geführt wurde, verbunden mit einem herzlichen Glückwunsch. Tom Levold TL: Ich möchte mit Dir darüber sprechen, wie sich Deine Lebensgeschichte als Lerngeschichte darstellt. Gibt es eine früheste Lernerfahrung? RWE: Bei uns war ja Lesen ein Privileg, weil wir arbeiten mussten. Und Lesen wurde nicht mit Arbeiten verknüpft. Wenn ich der Arbeit ausweichen wollte, d.h. verschwinden wollte, damit die mich nicht fanden, bin ich immer auf den Dachboden gestiegen. Da gab es wunderschöne alte gebundene Bücher, die waren von meinem Großvater, der war Lehrer. Da gab es Goethe und Schiller unter anderem, und da hab ich mich durch dieses Zeug durchgefressen und hab' unglaublich viel gelernt. Völlig unbeleckt von irgend etwas, aber gerade das war für mich eine ganz tolle Lernerfahrung, weil ich damit einen Raum für mich selber gefunden habe und weil ich weg von allem Pädagogischen und Schulmeisterlichen war und meine eigenen Gedanken gedacht habe. Lernen als etwas ganz Eigenes, aber immer in der Auseinandersetzung mit dem, was Du um Dich herum vorgefunden hast? Genau. Damit ging natürlich auch die Erfahrung einher, etwa nur ein Viertel von dem verstanden zu haben, was da geschrieben war, Hölderlin zum Beispiel, aber dass ich unglaublich viel einfach von mir her da herausbekommen habe. Ich erinnere mich noch immer an Szenen aus meiner damaligen Lektüre. Und konntest Du das mit irgendwem teilen? Ja. Geteilt habe ich das mit meinem Vater, der der Intellektuelle in der Familie war, als ich alle diese Bücher heruntergeschleppt habe vom Dachboden und eingebunden habe, weil die alle so ein bisschen zerfleddert waren. Da hat er mal sehr traurig gesagt „Ja, das habe ich auch alles mal gelesen - und dann weggelegt, weil eben das Geschäft dazwischen kam“. Wenn ich mir heute diese Bücher anschaue, die ich noch habe, da könnte ich das gar nicht mehr lesen. Es ist alles noch in der alten Sütterlin-Schrift geschrieben. Ich habe mir vieles davon später in modernem Druck gekauft und lese es auch noch, als Kind habe ich mich aber in diese alte Schrift hineingekniet. Lernen ist also mit Lesen ganz innig verbunden? Absolut: Mit Lesen und mit Sprache. War der Dachboden ein Ort, mit denen Du mit Lernen assoziierst? Und gibt es andere Orte? Eben der Dachboden, ganz allein hinter Kisten mich verstecken - und unten haben sie meinen Namen gerufen und ich habe nicht reagiert. Natürlich durfte man in den Ferien lesen, da waren wir in der Innerschweiz, über dem Vierwaldstätter See in einer Hütte. Und da haben sich eben alle von uns irgendwo unter einen Baum gelegt und gelesen. Wie waren Deine Erfahrungen mit Schule? Ja wenn ich das vergleiche mit Ruedi, meinem Mann, der war nicht in der gleichen Klasse wie ich, der hat unglaublich gelitten, weil er es so langweilig fand, und ich fand es so spannend, dass ich immer unter dem Tisch geschrieben habe – für mich selber. Das war wieder das Thema „eigenen Raum haben“, nicht arbeiten müssen, also nicht im Geschäft sein müssen. Heißt das, dass Lehrer eigentlich keine große Rolle gespielt haben? Ja, zunächst nicht. Auf dem Gymnasium war es dann anders. Da hatte ich eine wirklich gute, trockene, aber interessante Deutschlehrerin. Die hat mich zu Kleist hingeführt, weil Kleist ihr Lieblingsschriftsteller war. Mit der konnte ich gut und sie hat auch alle meine Aufsätze bestens bewertet und auch mir immer Zuspruch gegeben. Und später? Da war natürlich die Erfahrung mit Amerika. Da war die Fremdsprache - und ich habe ziemlich schnell bemerkt, dass ich mich in der Fremdsprache, also im Englischen, besser ausdrücke als im Deutschen, weil ich viel konzentrierter schreiben konnte. Ich habe viele gute Noten für das bekommen, was ich geschrieben habe, habe auch stundenlang in der Bibliothek gehockt und alles andere gelesen als das, was Pflichtlektüre war. So z.B. bin ich auf Jay Haley gestoßen. Wann bist Du in die USA gegangen? 64-74 waren wir da. Ich habe von 1965 bis 1967 dort studiert und 1967 ist auch unsere Tochter Barbara zur Welt gekommen. Irgendwie ist es unglaublich: Ich lese damals irgendwann die erste Nummer von „Family Process“ und bin überrascht, denn ich verstehe nicht nur alles, sondern finde auch alles toll. Jay Haley schreibt (als Gründungsherausgeber) über Family Therapy in einer Weise, die für mich ganz neu und faszinierend ist, und jetzt bin ich selbst im Board of Editors von Family Process. So ist das bei mir: Alles ein bisschen quer, eben nicht nur brav die Pflichtlektüre lesen, sondern eigenständig etwas finden. Dann habe ich Haley geschrieben, später ist er auch nach Ann Arbor gekommen, da haben wir wirklich eine gute Freundschaft mit ihm gewonnen. Er kam 1975 sogar nach Zürich. Aber um auf‘s Lernen zurückzukommen: Im Grunde bin ich da wie Ruedi, ich liebe das Eigenständige und nicht das, was man tun muss. Du bist ja mit 29 nach Amerika gegangen. Was war in der Zwischenzeit, zwischen Schule und Auslandsaufenthalt? Dazwischen habe ich die Schule für Soziale Arbeit in Zürich drei Jahre gemacht. Auch hier wieder dieses Muster: stundenlang in der Bibliothek gesessen und alles gelesen, was nirgends auf einem Lehrplan war. Da bin ich oft gerügt worden, weil ich nicht die Pflichtaufgaben gelesen hatte. Stattdessen hatte ich Freud gelesen. Ich habe mich riesig gefreut über die Zeit, die ich da verbracht habe. Wie ist der Entschluss zustande gekommen, ins Ausland zu gehen? Na ja, der kam nicht von mir (lacht). Ich hatte alle Vorurteile, die man haben kann. Ich habe die ganze Nacht vor unserer Abreise geheult, weil ich es unglaublich gemein von Ruedi fand, dass er in so ein scheußliches Land wollte mit mir. Als wir 1964 ankamen, da war gerade Präsidentschaftswahlkampf. Alles war genau so, wie ich es erwartet hatte, dieses Lautschreierische, diese Fernsehshows, dieses „In your heart you know he is right“-Zeugs. Dann gab es natürlich auch noch dieses Bild der USA, das viele Europäer aus den 50er Jahren hatten: tolle Kühlschränke, tolle Autos, also Technik. Was hast Du dann in den USA gelernt? In Ann Arbor, das ist eine mittelgroße Stadt mit starken deutschen Wurzeln, hatten wir im Nu viele Freunde. Aber an der Uni war ich natürlich die Ausländerin für relativ lange Zeit. Das war nicht einfach. Gegen Ende des Studiums hatte ich eine Enkelin von Freud als Tutorin, die mir sehr Mut zusprach, das hat mir schon geholfen. Aber die Ausbildung und vor allem meine Praxistage in der Psychiatrie, das war sehr anregend. Kann man sagen, Du hast Dir praktisch Deine Lehrer gesucht? Nein, das kann ich eigentlich nicht sagen. Ruedi hat ja bestimmt, dass wir an die University of Michigan gehen, d.h. wir hatten vorher noch etwas anderes, aber er hat gesagt, da gehe ich nicht hin. Die University of Michigan hatte aber ein wunderbares social sciences department. Dort habe ich Anatol Rapaport kennen gelernt und habe viel Zeug von ihm gelesen, Spieltheorie zum Beispiel - etwas, das nicht „offiziell“ anerkannt war, wobei ich aber eine Menge gelernt habe. War das Dein erster Lehrer in Systemtheorie? Ja. Das kann man sagen. Robert L. Kahn war ein anderer wichtiger Lehrer. Vor allem Richard Stuart, den ich immer noch sehr mag, so etwa vier Jahre älter als ich, ein New Yorker Jude, der Rabbiner war und Behavior Modification lehrte. Ich hatte zwar immer Mühe mit dem „technokratischen“ Teil, aber ihn als Person habe ich sehr geschätzt. Er hatte viel Witz und setzte den auch viel in Life-Gesprächen ein. Irgendwann hörte ich mal, wie er zu einer jungen Frau sagte: „You have to learn to shake hands, not penises“. Wer war noch in Deinem Umfeld in Ann Arbor, von dem Du sagen würdest, dass er Dich beeindruckt hat? John Kenneth Galbraith. Der hat die Ansprache auf unserer Abschlussfeier gehalten. Kurt Lewin, der Gruppendynamiker, war auch dort. Und gute Soziologen gab es, viel Gemeindesoziologie, eine ganze Reihe. Aber am meisten beeinflusst hat mich Stuart, der dann auch Jay Haley nach Ann Arbor gebracht hat, Bill Lederer, Clarissa Freud und eben Anatol Rappaport. Wie hast Du Jay Haley als Lehrer erlebt? Konnte man bei ihm gut lernen? Was ich besonders an ihm mochte - ich hatte ja viele Life-Gespräche bei ihm gemacht in seiner Gegenwart - war folgendes: wenn ich ihm sagte „Ich habe Angst“ oder „das war keine gute Therapie“, dann war er immer sehr unterstützend. Für manche war sein Stil vielleicht etwas unangenehm, ich hatte da nie mit ihm Probleme. War denn damals für Dich schon klar, wohin das für Dich gehen sollte? Nein, noch nicht. Ich war einfach neugierig, ich war sehr angeregt von Leuten, die denken konnten. Das war es einfach. Gab es für Dich Schlüsselmomente, in denen Du das Gefühl hattest, jetzt ist eine Weiche gestellt worden? Ja, das waren immer Situationen, wo ich merkte: „das willst Du auf gar keinen Fall“. Zum Bespiel in der psychiatrischen Klinik in Toledo, Ohio, eine Stunde weg von Ann Arbor. Da gab es einen tschechischen Psychiater, der hat uns eine Psychoanalyse von der blöden Art beigebracht. Bei dem habe ich auch eine Lehranalyse machen müssen. Ich war so viel weiter als er, dass er mich dann rausgeworfen hat. Die Arbeit in der Klinik selbst habe ich faszinierend gefunden, weil wir vor allem mit jungen Schizophrenen zu tun hatten und die Familien mit einbeziehen konnten. Gab es einen persönlichen Durchbruch für Dich? Ja. ich wurde dann irgendwann von Richard Stuart in ein Forschungsprojekt eingeschleust, da habe ich viele Life-Gespräche mit Videoaufnahme gemacht und die haben wir dann im Team gemeinsam betrachtet. Was ich da gelernt habe, also aus der gruppentherapeutischen Perspektive plus der systemischen, das half mir, irgendwann über mich hinauszuwachsen. Wir arbeiteten viel mit Familien mit drogenabhängigen Jugendlichen. Das war richtig gut - wir hatten ein Wissen, das direkt anwendbar war. Gab es auch Krisen? Hat Dich etwas verunsichert in diesem Prozess oder zum Zweifeln an dem gebracht, was Du gelernt hast in dieser Zeit? Eine Krise hat mich lange begleitet, allerdings etwas später. Als ich begann, Paartherapie zu machen, später in Zürich, bin ich völlig verzweifelt an den systemischen Konzepten, weil ich kein Konzept für Individuen hatte, was ich wusste, bezog sich alles nur auf Interaktion und die therapeutische Haltung, immer schön neutral draußen zu bleiben. Damals hätte ich fast die Flinte ins Korn geworfen. Ich habe dann irgendwann mal mit Mara Selvini darüber geredet und sie hat gesagt: „Das mit der Neutralität ist ohnehin schwierig. Du darfst ruhig das, was Du aus der Psychoanalyse kennst, in Deine Praxis mitnehmen“, aber das war eine Zeit in den 70er Jahren, wo alles immer nur auf Neutralität Wert legte. Wie hast Du die Situation nach Deiner Rückkehr 1974 in Zürich überhaupt wahrgenommen? Wir waren erstmal ganz offen für das, was da auf uns zukam. Und wir mussten ja auch Geld verdienen. Ruedi hat zunächst bei seinem Vater, der ja Dachdecker war, auf dem Dach mitgearbeitet. Ich hatte anfangs ein paar kleine Aufträge bei der Invalidenvereinigung. Ich wollte natürlich auch unbedingt Therapie machen. Das erste, was ich da mitbekam nach meiner Rückkehr, war ein „gamologisches Symposion“. Ein was? Ein gamologisches Symposion. Gamologie ist die Lehre von der Ehe. Das war von Josef Duss von Werth organisiert worden, der auch auf solche Begriffe Wert legte. Ich habe mich da gleich angemeldet. Am Abend vor dem Kongress wurde ich von Duss angerufen, die Heigl-Evers sei krank geworden. Er hatte mich auf der Anmeldeliste entdeckt und schon gehört, dass ich von Amerika kam. Ich wusste gar nicht, wer Heigl-Evers war. Ich hatte auch gar keine Ahnung, dass ich da mitten in die Höhle des Löwen, nämlich einer Analytikerin geraten war, jedenfalls habe ich ihren Workshop übernommen. Der war gerammelt voll von Psychoanalytikern, die meisten von der Frankfurter Schule, von denen ich auch nichts genaues wusste, und die haben mich dann zu attackieren begonnen, weil ich einen Mini-Rock trug! Das sei ja so etwas von Gegenübertragung, was ich da mache - also so ein ziemlicher Quatsch. Jedenfalls sind alle Psychoanalytiker empört aus dem Workshop herausgegangen und es fühlte sich ziemlich nach einer Niederlage an, bis dann am Nachmittag der Workshop überflutet wurde von anderen Kolleginnen und Kollegen, die sich nicht an meinem Minirock störten und absolut aktiv waren. Das Schandwort vorher war ja „Agieren“. Aber ohne Agieren kann man nicht Therapie machen, sagte ich, das war natürlich böse. Am Schluss kam dann Jürg Willi dazu, der damals schon mit Duss zusammenarbeitete, und lud mich ein, ein Seminar für die Therapieausbildung am Institut zum Thema Rollenspiele zu machen. Ich war höchst verblüfft, dass man das noch lehren musste, habe es aber dann gemacht. Wann hast Du dann im Institut für Ehe und Familie angefangen? Eigentlich sofort. Duss hat mich eingeladen 1974, 1975 war dann der große Kongress, wo ich schon Jay Haley, Virginia Satir geholt habe. Zunächst habe ich in Teilzeit gearbeitet, die Kinder waren ja noch sehr klein. Aber ich habe eigentlich immer sehr viel mehr gearbeitet als in meinem Vertrag drinstand, weil ich nicht nur viel Therapie machte, sondern auch viel an Ausbildung - ich hatte eben auch die guten Verbindungen in die USA. Irgendwann habe ich beantragt, dass ich Co-Leiterin des Institutes werde. Duss hat das dann auch befürwortet, es war aber doch konflikthaft und hat dann schließlich zum Bruch geführt. Wie hast Du den Unterschied zwischen den USA und der Schweiz in dieser Zeit erlebt? Als ich 1980 mit der Familientherapie anfing, gab es ja in Deutschland und der Schweiz noch keine durchorganisierte familientherapeutische Landschaft, sondern eher eine große Spielwiese und vor allem eine begeisterte Aufbruchstimmung, aber Du hast ja noch die allerersten Anfänge mitbekommen. Es war alles noch ein bisschen schlafend, aber gerade diese Situation hat mich auch sehr stimuliert. Ich war plötzlich in der Rolle der Pionierin. Jürg Willi und ich waren die Einzigen, die vor KollegInnen Life-Gespräche durchführten, wir schrieben und veröffentlichten. Es war ja für mich selbstverständlich, dass man Familientherapie lehrt, indem man zeigt, was man tut. Ich war dann auch verantwortlich dafür, dass eine Videoanlage eingerichtet wurde. Im Grunde warst Du ja sehr schnell in der Position, das, was Du selbst lerntest, sofort selbst weitergeben zu müssen, dass also Lernen und Lehren sehr nahe beieinander waren. Was findest Du bei der Organisation von Lernprozessen besonders bedeutsam? Ganz wichtig ist, dass man gute Kolleginnen und Kollegen hat, die man richtig wertschätzen kann. Und die auch kritisch sind. Nachdem Doris Bischof-Köhler bei mir eine Weiterbildung gemacht hatte, hat ihr Mann, Norbert Bischof, der einen Lehrstuhl für Psychologie an der Universität Zürich hatte, mich angefragt, ob ich bei ihm nicht einen Lehrauftrag wahrnehmen möchte. Er war sehr sehr kritisch, aber auf eine gute Weise, nicht destruktiv, und das habe ich immer sehr geschätzt. Jürg Willi war auch einer davon, wir haben uns sehr ernst genommen, auch wenn wir über manches verschiedene Ansichten hatten. In anderen Worten: Lernen heißt für mich – vor allem, wenn man schon ein bisschen weiter ist – mit Leuten zusammen zu kommen, die ihr Wissen teilen wollen und die neugierig sind. Ist es nicht auch ein Ansporn zu lernen, wenn man anderen etwas anbieten möchte? Dass man zunächst einmal sagt, ich kann das, und dann ist man durch diese Selbstfestlegung auch gezwungen, sich das genau zu erarbeiten, um es auch weitergeben zu können? Oh ja. Machmal setzt man einen guten Titel in die Welt - und vier Wochen vor dem Workshop stellt man plötzlich fest, ich verstehe ja gar nichts davon – und dann muss man halt lesen, oder mit Leuten darüber reden. Was magst Du an Deinen Lernweisen besonders gerne? Zwei Dinge. Das eine ist: Lernen, während ich etwas tue. Das betrifft vor allem meine Therapien. Also erst ein Thema vor mir zu haben, z.B. Familiengeheimnisse oder so etwas, und dann einfach durch meine Erfahrungen und mein Denken und meine Modelle situativ zum guten Handeln zu kommen. Das andere ist einfach, Zeitschriften zu studieren und: im Bett zu lesen. Wenn man Hunger hat, muss man sich gut nähren. Hast Du einen bestimmte Technik? Was hilft Dir beim Lernen? Das geht nur über Interesse. Eben Neugier. Wenn ich mit einem Thema beschäftigt bin, wie z.B. Anorexie, dann lese ich erstmal alles, was es an Neuem zum Thema gibt. Da bin ich dann schon ziemlich selektiv. Streichst Du Dir Sachen an? Ja. Ich streiche Sachen an, mache aber auch Kopien, weil ich nicht die ganzen Bücher versauen will, und markiere dann auf den Kopien die wichtigen Stellen. Erinnerst Du Dich an das, was Du angestrichen hast, oder wie kommst Du später wieder auf Deine eigenen Spuren? Nein, ich muss dann z.B. Mappen anlegen, in denen ich das Material sammle. Es kommt einfach drauf an. Wenn ich mich mit etwas ganz Neuem beschäftigte, lasse ich den Computer erstmal außen vor. Wenn ich mich aber mit Dingen beschäftige, mit denen ich mich gut auskenne, dann hilft mir der Computer schon, darauf hinzuweisen, was wo aufgeschrieben ist. Neues, das muss ich immer noch von Hand bearbeiten. Wie fließen diese Lernerfahrungen in das Curriculum der Weiterbildung ein? Das ist ganz unterschiedlich, weil wir im Team unterschiedlich sind. Es gibt Kollegen, die geben ganz viel Papier zum Lesen heraus, ich gebe wenig Kopien, aber schreibe Punkte auf, die mir wichtig sind. Das kann man sehr verschieden machen. Wir werden ja von der Weiterbildungsgruppe mit Fragebogen evaluiert. Wenn dann die Rückmeldung kommt, dass man mit der Theorie-Arbeit Schwierigkeiten hat, dann ist das für mich allerdings ein Problem. Manchmal kommt von den Weiterbildungsteilnehmern nichts. Wenn die nicht begierig sind, nicht lernen wollen, dann komme ich mir immer mehr wie eine alte Katze vor, die den Jungen zuschaut, wie sie sich mit den Mäusen verhalten und irgendwann dann sich selbst die Maus nimmt und frisst. Ich bin einfach sehr ungeduldig, wenn die nicht lesen oder lesen wollen. Was wirst Du machen, wenn Du Dich aus dem Weiterbildungsbetrieb zurückgezogen hast? Was ich zukünftig tun will, ist sicher, weniger pragmatisch zu lesen, sondern offener, vielleicht entsteht etwas Neues daraus. Wird es mehr Spielraum geben, wenn Du Dich aus dem Tagesgeschäft des Meilener Instituts zurückgezogen hast? Ich werde wahrscheinlich zwei Tage in der Woche in meinem Büro sitzen, aber auch viel ordnen und wegwerfen - und schauen, wo ich mich noch vertiefen möchte. Für Dich ist Lernen eigentlich das Reich der Freiheit und der Notwendigkeit zugleich. Ja. Und die Notwendigkeit will ich ein bisschen nach hinten schieben. Könntest Du Dir Dich selbst als eine Teilnehmerin in WB-Kursen vorstellen? Nein (lacht), ich glaube nicht. Dafür bin ich zu ungeduldig. Könnte man sagen, Dein Lernmuster ist, dass Du immer wieder auf den „Dachboden“ gehen und Deine eigenen Studien anstellen musst? Das trifft es ziemlich genau. Herzlichen Dank für das Gespräch! |
||||
|
||||||||
Besuche seit dem 27.1.2005: 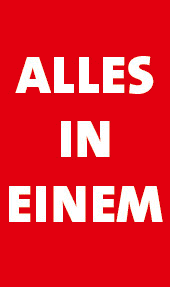  |

